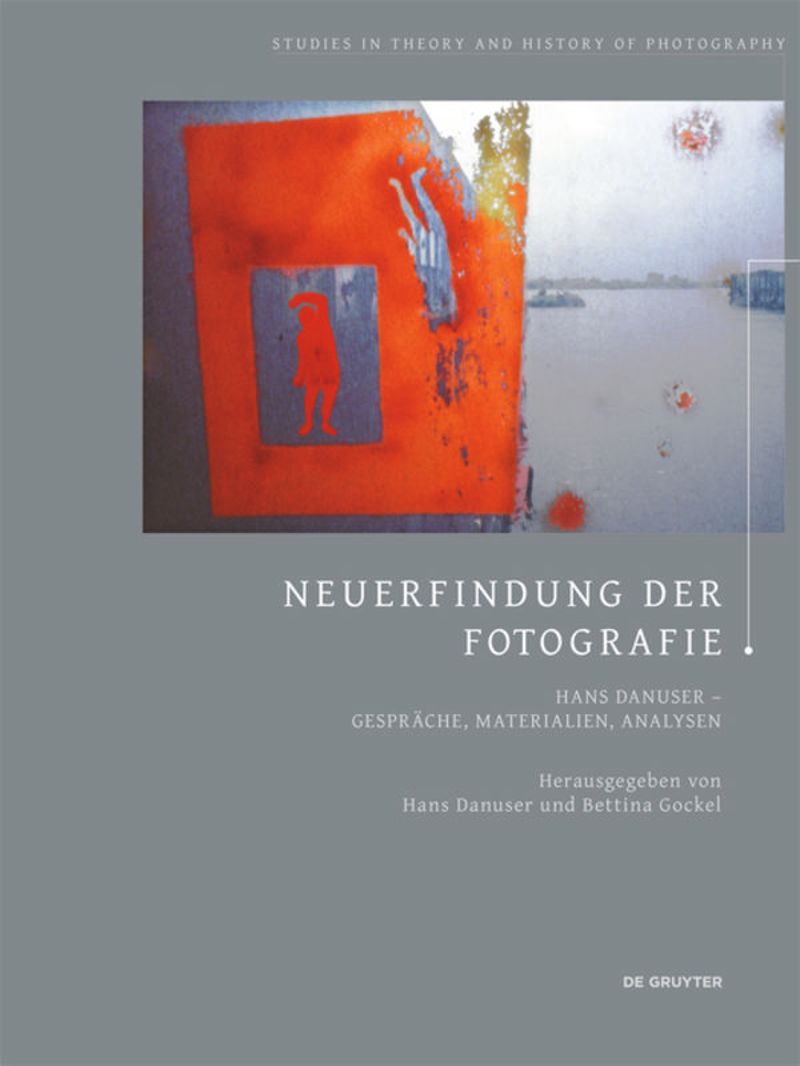Das Eigene im Fremden – persönliche Erinnerungen
Die Welt der Fotografie in der Schweiz war zutiefst ambivalent, als ich sie Ende der siebziger Jahre, zuerst mit Neugierde und dann mit ersten Texten, etwa zu belgischen Sozialwohnungen in Fotografien von Sophie Ristelhueber und François Hers oder zu anonymen Hochzeitsfotografien, zaghaft und mit der Zeit selbstbewusster betreten habe. Die Veröffentlichungen erster Texte in der Frauenzeitschrift „Annabelle“, in der Berner Kulturzeitung „Zytglogge“ oder im volkskundlich-soziologischen Heft „Der Alltag“ weisen daraufhin, dass es damals keinen zentralen Medienplatz der Auseinandersetzung mit Fotografie gegeben hat. Ergänzend kann man beifügen: Und in der Schweiz bis heute nicht gibt.
Dieser Eindruck von Ambivalenz entstand in meiner Erinnerung durch verschiedene Ursachen: Auf der einen Seite war die Fotografie in einer Identitätskrise. Sie hatte definitiv ihre erste und zentrale Aufgabe, das visuelle Berichten über die Welt, ans Fernsehen abtreten müssen. Gleichzeitig war sie über den zunehmenden Einsatz von Fotografien in der Kunstwelt irritiert, vor allem über die Art und Weise des Gebrauchs, der offensichtlich von anderen Prämissen ausging, als das in der Tradition der Fotografie bisher vorgesehen war. Auf der anderen Seite wurden die angestammten Räume enger: die Zeit der grossen aus der Welt berichtenden Zeitschriften und Buchverlage ging langsam zu Ende. In der Folge wurden die journalistischen Aufträge an Fotografen kleiner, schneller, knapper, und letztlich auch unverbindlicher. Es ist deshalb auch die Zeit, in der Auftragsfotografen anfingen, ihr editoriales Betätigungsfeld zu verlagern, zum Beispiel, indem sie neu für Jahresberichte von Unternehmen arbeiteten. Und gleichzeitig existierten noch kaum Räume, in denen die Fotografie ein anderes Verständnis, mögliche neue Rollen hätte austesten, ausprobieren können. Zeitgenössische museale Ausstellungsräume gab es in Zürich kaum, Non-Profit-Räume wie heute praktisch gar keine. Die städtischen Institutionen Helmhaus und besonders der Strauhof waren grosse Ausnahmen in einer aus heutiger Sicht sehr kargen Infrastruktur. Zwei, drei Galerien halfen ebenfalls mit, der Fotografie eine Plattform zu bieten.
Es waren auch kaum Geldquellen vorhanden, die ein mögliches Feld der Erkundung, Erforschung, der Diskussion ermöglicht hätten. Die Stipendienlage war in gewisser Weise eine Krux: Künstler gaben im Eidgenössischen Stipendium für Kunst ein, Fotografen im Eidgenössischen Stipendium für angewandte Kunst. Wo aber sollten künstlerische, forschende FotografInnen ihre Projekte eingeben? Bei der angewandten Kunst wurden sie abgelehnt, weil sie weder dokumentarisch, noch anderswie „angewandt“ waren, und bei der freien Kunst in der Regel ebenso, weil hier der Umgang mit Fotografie lange Zeit kaum ernst genommen wurde. Sie fielen also zwischen Stuhl und Bank. Nur selten haben damals Künstler mit fotografischen Arbeiten bereits ein eidgenössisches Kunststipendium erhalten. Urs Lüthi war 1972 der allererste und lange Zeit der einzige unter ihnen.[1] Hans Danuser wiederum war der erste Fotograf, der 1984 das New Yorker Atelier der Stadt Zürich zugesprochen erhalten hatte.[2] Diese materiellen, infrastrukturellen Schwierigkeiten verdeutlichen, wie unsicher, unklar die Lage angesichts eines schleichenden, versteckten Wandels war, der das Sehen und Verstehen und dann auch das Erstellen von Fotografie grundsätzlich in ein neues Licht stellte. Eine zusätzliche Verschärfung, ja fast eine Verquälung erfuhr die Fotoszene in der Schweiz Mitte der achtziger Jahre. Es baute sich eine heftige Spannung zwischen der Schweizerischen Stiftung für die Photographie mit Sitz am Kunsthaus Zürich (seit 2003 ist sie in Winterthur beheimatet und nennt sich seither Fotostiftung Schweiz) und dem 1985 neu eröffneten Musée de l’Elysée in Lausanne auf. Der umtriebige Charles-Henri Favrod, damals Präsident der Schweizerischen Stiftung für Photographie, baute das Elysée offenbar mehr oder weniger hinter dem Rücken der eigenen Stiftung in Zürich zum neuen ständigen Museum für Fotografie in der Westschweiz um.[3] Das ungeschickte Vorgehen vergraute die Wetterlage einer eher schwachen Foto-Szene noch stärker.
Diese Ambivalenz war bis zur Ausstellung „Wichtige Bilder“, die Martin Heller und ich im Frühsommer 1990 am Museum für Gestaltung eingerichtet hatten, deutlich spürbar. Und sie hielt weit darüber hinaus an. Die Erwartungshaltungen an die Ausstellung waren hoch und vielfältig. Zum einen, weil es seit der Ausstellung der Schweizerischen Stiftung für die Photographie 1981 im Kunsthaus Zürich und seit der dritten Strauhof-Ausstellung zur Fotografie 1982/83 keine grosse Übersichtsausstellung mit Fotografie aus der Schweiz mehr gegeben hatte, zum anderen, weil etwas in der Luft lag, weil die Nerven wegen der andauernden Identitäts- und Auftragskrise strapaziert waren. Das Zusammenführen von fotofotografischen und kunstfotografischen Positionen der achtziger Jahre in der Ausstellung und im Begleitbuch[4], auf der einen Seite mit Fotografen wie Roland Schneider, Christian Vogt, Valdimir Spacek, Hans Danuser, auf der anderen Seite mit KünstlerInnen wie Hannah Villiger, Olivier Richon und Fischli Weiss, führte zu Aufschreien und Protesten. Die Ausstellung wirkte wie ein Ventil, um angestautem Ärger, aber auch latenter Unsicherheit Luft zu verschaffen. Lautstark wurde die eigene Position hervorgehoben und die andere Position „schlecht“ gemacht, wurde Fotografie gegen Kunst und Kunst gegen Fotografie ausgespielt. Beide Lager schenkten sich wenig. Hugo Loetscher, Schriftsteller, in diesem Zusammenhang jedoch vor allem früherer Redaktor der Kunstzeitschrift „du“, bat mich zur persönlichen Aussprache auf seine Terrasse in der Zürcher Altstadt. Allan Porter, der ehemalige Chefredaktor des Magazins „Camera“, zum Gespräch in seine Luzerner Wohnung. Mein Angebot zur Aussprache mit Alberto Flammer, dem damaligen Teamleader der Tessiner Fotografie, wurde ausgeschlagen. Alle drei bekundeten Mühe mit den künstlerischen Positionen und mit der grundsätzlichen Problematisierung des fotografischen Schaffens. Umgekehrt fragten mich einige der KünstlerInnen, weshalb in der Ausstellung auch Dokumentarfotografen gezeigt würden. Vehemente Statements wie „Ich bin Künstlerin und keine Fotografin!“ oder „Das ist Kunst, keine Fotografie!“ haben sich in meiner Erinnerung festgesetzt.
Am besten jedoch illustriert der Artikel von Niklaus Flüeler in der „Weltwoche“ die damalige Situation. Er benützte die kurze Sommer-Überlappung von „Wichtige Bilder“ mit der grossen Magnum-Ausstellung am Kunsthaus Zürich zu einem ganzseitigen Artikel mit dem Titel „Grösser als Magnum ist keine Photographie“ und ergänzte im Untertitel „Was wirklich Wichtige Bilder sind, zeigen zur Zeit zwei Ausstellungen in Zürich.“[5] Flüeler kritisiert darin ausführlich die Ausstellung und das Buch „Wichtige Bilder“ und konstatiert unter anderem, dass sich der Autor (Urs Stahel) unglücklicherweise in der Unterscheidung von Fotografie und Photographie verheddere. Das „erkenntnistheoretische Brimborium“ erweise sich als fragwürdig und bedeutungslos, zumal man nun im Kunsthaus Zürich sehen könne, was tatsächlich wichtige und bedeutende Fotografie sei. Der Titel des Artikels gab seine Vorliebe überlaut preis: Flüelers Kritik an „Wichtige Bilder“ kulminierte in der Feststellung, dass es die Leistung von Magnum sei, eine „unerschrockene, sozial und mitmenschlich engagierte Dokumentation alltäglichster Wirklichkeit zu liefern“, diese „Wirklichkeit ungekünstelt und ungeschminkt, aber mit höchstem handwerklichem Können, persönlichem Engagement und Einsatz bis an die Grenzen des physisch und psychisch gerade noch Ertragbaren unerschütterlich zu dokumentieren.“[6]
F und Ph: Die beiden Schreibweisen standen damals (und manchmal heute noch) für zwei Welten, für zwei Vorstellungen dessen, was Fotografie ist. F in der Regel für die progressive, Ph für die herkömmliche Sicht- und Gebrauchsweise. Ich habe selten ein Feld kennengelernt, in dem laufend und mit derart grosser Vehemenz darüber gestritten wurde, was die Fotografie ist und vor allem, was sie zu sein hat! Die Heftigkeit der Sollbehauptungen nahm parallel mit der Fragilität der Situation zu. Je weniger klar war, welche Fotografie und welche Wirklichkeit gemeint waren, desto lauter wurden die Stellungnahmen. Es ist nicht ganz einfach zu benennen, was für Haltungen durch die beiden Schreibweisen verkörpert wurden. Es handelte sich weit eher um einen dussligen Gefühlsunterschied zwischen Fotografie und Kunst, zwischen herkömmlicher und neuer Fotografie, zwischen Bewahrern und Erneuerern, als um eine scharfe kognitive, beschreibbare Abgrenzung. Vermutlich hing letztlich alles an einem psychologischen Faden, ging es doch um den Unterschied zwischen Angst vor Verlust des Herkömmlichen und Mut zum Neuen, Gegenwärtigen. Wobei die Vertreter der Schreibweise mit Ph sich ohne Umschweife auf die Moderne, auf die Bauhauszeit der Fotografie bezogen, die selbst allerdings Fotografie immer und programmatisch mit F geschrieben hat.
So diffus bereits diese beiden Felder sind – sie wären eine eigene Untersuchung, eine Art von Stimmungsgeschichte wert –, gilt es noch ein drittes Feld beizufügen: In den siebziger und frühen achtziger Jahre wurde sehr oft von „Creativer Photographie“, „Kreativer Fotografie“ oder Mischungen der beiden gesprochen, hier nun ohne einen Überzeugungsgraben zwischen den Schreibweisen. Quasi in Stein gemeisselt hat diesen Begriff das „Center of Creative Photography“ in Tuscon, Arizona. Der Begriff tauchte eine Weile lang überall auf, doch vor allem machte er sich in den wenigen Fotogalerien breit. In Zürich besonders in der Nikon Gallery an der Schoffelgasse 3. Sie war ein wichtiger, zumindest ein rege besuchter Ort für zeitgenössisches fotografisches Schaffen in den siebziger und frühen achtziger Jahren. Neben Ausstellungen von bekannten internationalen Fotografen und Fotografinnen – u.a. von Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Duane Michaels, Weegee –, erinnere ich mich an eine Ausstellung zum Motiv „Spaghetti“. Kreative Fotografen, kreative Art Directors verschoben ein Thema der Auftragsfotografie, hier konkret der „Food Photography“, in ein freies Thema, in den freikünstlerischen, kreativen Bereich. Jede/r der ausgestellten FotografInnen versuchte, so originell wie möglich zu sein, oft mit zweifelhaften Resultaten. Diese Ausstellung ist Beispiel für eine Szene, in der Auftragsfotografen – die in der Sachfotografie, aber auch in Mode und Werbung tätig waren – mit dem Entstehen von ersten Galerien, von Räumlichkeiten als Nebenbeschäftigung „kreative Fotografie“ betrieben. Ein Spielfeld, in dem das Aufeinanderprallen von gutem und schlechtem Geschmack auffälliger war als allfällige Haltungs- und Konzeptunterschiede.
Einige der beschriebenen Situationen und Reaktionen haben regionalen oder nationalen Charakter, die Grundstimmung der Unsicherheit hingegen war international. Sie betraf den realen Wandel der Auftragslage, die gegenseitige Durchdringung von „Wirklichkeit“ und medialer Welt und den intensiven Gebrauch der Fotografie in der Kunst – alle drei Entwicklungen waren verbunden mit einer grundsätzlich neuen Einsatz- und Verstehensweise des fotografischen Bildes. Doch die Art und Weise, wie je nach Region, Land oder Schule damit umgegangen worden ist, war sehr unterschiedlich.
Meine persönliche Bekanntschaft mit dem sich verändernden fotografischen Verständnis in der Kunst der Schweiz begann mit der Ausstellung von Manon, der Installation „Das lachsfarbene Boudoir“ 1974 in der Galerie Li Tobler in Zürich, und den nachfolgenden Fotoserien der Künstlerin. Mit Urs Lüthis Fotoperformances, die ich in einer winterkalten Gessnerallee in Zürich oder in der Galerie von Pablo Stähli erlebte, mit Katalogen von berühmten Ausstellungen, die ich nicht besucht hatte, wie „Visualisierte Denkprozesse“ (1970) und „Transformer“ (1974), beide im Kunstmuseum Luzern, und zwei der drei Strauhof-Ausstellungen in Zürich zum Thema Fotografie. Später waren Ausstellungen in der Kunsthalle Basel wichtig, unter anderen auch die „Fotowerke“-Ausstellung von Balthasar Burkhard (1983), vor allem aber die Mitarbeit an der Zeitschrift „Der Alltag“ um 1980 und deren unbeschwerter, undogmatischer Einsatz von Fotografie, zum Beispiel eine rund 50 Seiten lange, aufregende Bildstrecke von Walter Pfeiffer in schlechtem schwarzweissem Offsetdruck.[7] In diesen und ein paar wenigen weiteren „Keimzellen“ – in der Romandie zum Beispiel war das Média-mixte-Atelier an der Ecole supérieure d’art visuel in Genf ein Denkzentrum der zeitgenössischen medialen Kunst – wuchs ein anderes Verständnis von Fotografie heran, als es in den klassischen Foto-Orten der Schweiz gezeigt, gelehrt und diskutiert worden ist.
„Im Ausklang der Moderne lernte die Kunst das Lachen wieder“ (Beat Wyss)[8]
Der Paradigmen-Wechsel, der uns Fotografie so anders anschauen, einsetzen und verstehen lässt, hat sich schon früher angekündigt. Zumindest der Keim dazu war bereits in den fünfziger Jahren gesetzt worden. In der Mitte des Jahrzehnts trat Robert Rauschenberg mit seinen „Combines“ an die Öffentlichkeit. Skulpturen, in denen er Möbel, Reifen und andere disparate Materialien vereinte sowie Malereien, die er mit Fotografien versetzte. In seinen Siebdrucken der sechziger Jahre spielte die Fotografie eine noch wichtigere Rolle. Gefundene oder selbstgemachte Fotos werden mittels Siebdruck überlappend aneinandergereiht oder zu einem Block, einer popartigen Assemblage geformt. Auffallend ist dabei, dass er „irgendwelche Fotografien“ verwendet hat. Das Explosive am neuen Einsatz von Fotografien war, dass sie zuerst als ausserkünstlerisches Material und als Repro-Fundobjekte in die Malerei integriert wurden, und so als eine Art unkünstlerische Realzeichen fungierten.
Fast zur gleichen Zeit begann auch Andy Warhol, Siebdrucke einzusetzen und vorgefundene, ausgeliehene, selbstgemachte Fotografien in blockartige, sequenzartige Bilder zu formen. Seine „Disaster Paintings“ von 1963 sind so eindrücklich, weil sie das Disaster durch die Wiederholung gleichzeitig verstärken und auflösen, gleichzeitig erheben und in Frage stellen. Sein System der fast atemlosen Wiederholung, Aneinanderreihung von Fotografien in seinen Siebdrucken spielt mit dem Schrei und seiner Auflösung, der Behauptung und der Reduktion. Fotos werden als grell-düstere Pop-Zeichen eingesetzt und durch die Wiederholung entikonisiert, als Reproduktion gekennzeichnet und entleert, „entwertet“.
Douglas Crimp nannte die Siebdrucke von Rauschenberg und Warhol später eine hybride Form des Drucks, den Übergang vom Einsatz von Produktionsmitteln zum Einsatz von Reproduktionsmitteln und machte daran erste Elemente des Postmodernen fest: „Die entleerende Wirkung, die Erschöpfung der Aura, das Anfechten der Einmaligkeit des Kunstwerkes, hat sich in der Kunst der letzten beiden Jahrzehnte beschleunigt und intensiviert. Von der Vervielfältigung im Siebdruck hergestellter fotografischer Bilder im Werk von Warhol bis zu den industriell gefertigten, repetitiv angelegten Arbeiten minimalistischer Bildhauer – alles im radikalen künstlerischen Schaffen schien sich verschworen zu haben, um die überkommenen kulturellen Werte, genau wie Walter Benjamin gesagt hatte, zu liquidieren.“[9]
Dieser Bewegung an der Ostküste Amerikas, diesem neuen künstlerischen Spiel mit fotografischen Realzeichen, dieser Suche nach Realitätsfetzen, entsprach in Europa die Bewegung der „Nouveaux Réalistes“ mit Jean Tinguely, Nicki de Saint Phalle, Daniel Spoerri, Raymond Hains, César, Mimmo Rotella und anderen. Nicht in allem stimmte man überein, sicher jedoch in der Absicht, auf der Suche zu sein nach einem Ausweg aus den Dogmen des Modernismus, aus der Sackgasse der Abstraktion, des grossen Ernstes. Die Europäer waren, so ihr Gruppenname, die neuen Realisten, die nach der Moderne eine Anbindung der Kunst an die Realität suchten. Hingegen hatten sie kaum eine erklärte Haltung zum Bild. Raymond Hains schaffte mit seinen Plakatabrissen, den „Affiches lacérées“, zumindest den Spagat zwischen Informel und Neuem Realismus. Doch in New York ging das Bildverständnis weiter. Nicht was da ist zählt, sondern wie man es anschaut und einsetzt. Die Einheit des Bildes wird aufgebrochen, einfach oder mehrfach: in den Sehenden und das Bild, zusätzlich in das Bild und die Wirklichkeit, das Bild als Träger einer Botschaft (englisch picture), als signifiant, und das Bild als Botschaft, als Gehalt (englisch image), als signifié. Flächig wäre die Verbindung „Wirklichkeit-Zeichen-Betrachter-Bedeutung“ als ein varierendes Viereck darzustellen, anschaulicher jedoch wird sie räumlich gedacht, als eine Pyramide mit vier Eckpunkten, wobei wahlweise einer der vier Punkte die Spitze sein kann. Die Vorstellung des Bildes als eines nie ganz festgelegten Zeichens, das ein Eigenleben hat, auf das Betrachter projizieren, das die Wirklichkeit „überschattet“, „überblendet“, manifestiert sich in den Arbeiten Warhols und seiner Zeitgenossen.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Bilder noch mit einem heiligen Ernst versehen, mit der Kraft künstlerischer Statements und Manifeste in dieser Zeit vergleichbar.[10] Das Bild trat mit erstaunlicher Wucht auf, als sei es der wahre Prospekt der Welt, als sei es Gesetzestafel, Exerzierfeld oder ein Plan, eine Schablone, mit der man die Welt nicht nur repräsentieren, sondern auch zu dirigieren vermöge: als entspräche der weissen Leinwand die hohe, reine, absolute Zeit, der schwarzen die leere, die aufgehobene Zeit, das Nichts, der roten Leinwand die aktive, blutige Zeit, die Handlung. Abstrakte Leinwände, die jedoch höchst bedeutungsgeladen gemeint waren. Diesen Ernst, diesen Kanon, dieses Verständnis wollte man in den sechziger Jahren brechen, denn das stimmte nicht mehr mit der eigenen Welterfahrung überein, war in der Gefühls-Mischung aus existenzieller Nachkriegs-Erschütterung (mit grossem Glaubensverlust) und startender Hochkonjunktur, der später umfassenden Kommerzialisierung der Welt, obsolet geworden. Für viele Künstler sind die sechziger Jahre deshalb zutiefst ein Jahrzehnt der Abkehr: von den abstrakten, reinen, nach Objektivität strebenden Gestaltungsweisen und ihrem gedanklichen Überbau, vom Werk als geschlossener, absoluter Entität; von der Vorgabe des kunstwürdigen Materials und vom Stildenken. Absage auch an die grosse Form, die grosse Erzählung, die übergreifende Wahrheit, das Absolute. An ihre Stelle trat die Einsicht in die Bedingungen des eigenen Tuns, die Beschränkung der Aussage und Erforschung der Mittel und Methoden.
Was bedeutete das strukturelle Aufbrechen der Vorstellungs-Entität „Bild“ konkret für das reale gemalte und fotografierte Bild? Auf der Fotoebene manifestierte sich der Zweifel in der Form einer Absage an das Einzelbild, eine Ausrichtung hin zu Reihen, Serien, Sequenzen von Fotografien; in der Malerei als Sprengung des Gevierts, der Begrenzung des Bildes, als Auslaufen des Bildes in die Wand, in den Raum und ins Leben hinein. In beiden Handlungsweisen ging es ums Entmystifizieren, ums Entschlacken von Bedeutung, von Gefühlsschwere. Von nun an reichten Träger (Chassis, Leinwand oder Fotopapier) und eine Oberfläche (Grundierung, Farbauftrag oder Fotoemulsion) sowie ein paar Gedanken, Ideen, Versuche, Aspekte. Oder die Handlung wurde als Prozess zum Zentrum der Betrachtung und ersetzte das Resultat, sie löste das Kunstwerk als statisches Objekt in Performances, Happenings auf. Letztlich stellte die Idee das Bild in ihren Schatten. Bisweilen gingen die neuen Erkundungen der Wahrnehmung, des Bildes, gerade auch in der Schweizer Kunst, lächelnd-spielerisch-forschend vonstatten: Das Erhebende einer lichtdurchfluteten Kuppel, eines Sternenhimmels wurde von Markus Raetz mit Polaroidfilm vor Neonlicht als Salatsieb aus Plastik fotografiert und so schmunzelnd entlarvt. Beat Wyss brachte dies auf die Formel: „Im Ausklang der Moderne lernte die Kunst das Lachen wieder“[11]
Konzeptualisierung der Kunst, neuer Gebrauch des fotografischen Bildes
Diese Entwicklung führte für manche Künstler zu einem eigentlichen Auszug aus dem Atelier, zum Beispiel in die Natur hinaus. Robert Smithson mit seiner berühmten „Spiral Jetty“ (1970), Richard Long mit „Walking a Line in Peru“ (1972), aber auch Klaus Rinke oder Hamish Fulton verliessen das Atelier und die Stadt und begannen in der Landschaft zu wandern und da ihre ephemeren Zeichen, ihre Spuren zu setzen: Spiralen, Wegmarken, Kreise, Pfade. Flüchtige Zeichen ihres Weges, der Zeit, die sie verbracht, der Tätigkeit, die sie vollbracht haben. Spuren, die dann mittels Fotografie dokumentiert wurden, weil sie sehr vergänglich waren. Zeichen, die oft nur über die Fotografie die Kunstwelt erreichten.
On Kawara schickte Postkarten von seinen Handlungen, seinem Unterwegssein, seinem Da-zu-einer-bestimmten-Zeit-Gewesen-Sein: „I Got Up“ (1968-1979). Hanna Darboven begab sich auf wiederkehrende, stereotype, fast litaneiartige Reisen vor Ort, auf den Papieren, die sie beschrieb und mit Fotografien versah. Einen ähnlichen Weg wie die Earth Art oder Land Art-Künstler beschritten die Body Art, Performance- oder Happening-Künstler, die das Immobile zugunsten des Mobilen, das erstarrte Objekt zugunsten der Bewegung in Raum und Zeit auflösten. Auch sie setzten Fotografie zuerst nur als reine Dokumentation ein, bis sie sie allmählich als ihr neues Medium begriffen, bis sie die Performance nur noch für die Fotografie inszenierten, bis die Foto-Performance entstand. Erinnert sei hier besonders an die Ausstellung „Transformer: Aspekte der Travestie“ im Kunstmuseum Luzern (1974), die vom transformierten Ich und vom transformierten Bildverständnis handelte, und an Künstler und Künstlerinnen wie Urs Lüthi, Jürgen Klauke, Luigi Ontani, Valie Export, auch an Bruce Naumans „Self Portrait as a Fountain“ (1966/67).
John Baldessari, einer der zentralen Konzeptkünstler der amerikanischen Westküste braucht die Fotografie in seinem Werk „Aligning: Balls“ (1972), um mit der typischen Lockerheit kalifornischer Kunst über den Wahrnehmungsprozess nachzudenken, über die Relativität der Wahrnehmung und darüber, wie beabsichtigt oder unbeabsichtigt Bedeutung entsteht. Jan Dibbets’ Werk konzentrierte sich über Jahrzehnte fast ausschliesslich auf die Natur der Wahrnehmung, versucht den Wahrnehmungsprozess zu visualisieren, ihm eine anschauliche Form zu geben. Kenneth Josephson überlagerte mit in die Bildrahmung hinein gehaltenen Postkarten zwei Repräsentationene Wirklichkeit. Luigi Ghirri formulierte mit feiner Visualität das Ein- und Ausschliessen durch den Entscheid des Suchers, führt uns auf eine imaginäre Reise durch den Atlas und denkt früh über das Sehen von Dingen und das Sehen von Betrachtenden nach. Sigmar Polke betrieb seine skurrilen Bildcollagen und Bildreihen der siebziger Jahre wie kleine Meisterstückchen der Ironie mittels Fotografien, Zeichnungen, Drucken und Textzitaten.
John Szarkowski, der Direktor des Fotodepartments am MOMA in New York, hielt 1975 in einem Artikel für die „New York Times“ fest: „Einige zeitgenössische Künstler, die wenigstens nominal, also theoretisch als Maler begannen, und die in der Zwischenzeit ihren Weg durch nichtpiktorale Kunstformen gegangen sind (Happenings, Konzeptkunst, Land Art, Systems Art etc. ) haben eine schnelle Wertschätzung demonstriert, eine Wertschätzung der Fotografie als eine Technik, welche die Wege der menschlichen Erfahrung dokumentieren kann. Solche Künstler, die von Duchamp und Tinguely gelernt haben, dass der Kunstakt nicht mit der Geschicklichkeit der edlen Herstellung einhergehen muss, haben schnell gelernt, dass die Fotografie ein Kunstwerk sein kann, ohne ein offensichtlich schönes Objekt zu sein.“[12]
In diesem Statement ist ein Hauch von Abschätzigkeit zu spüren, vermutlich weil Szarkowski als Fotograf und Kurator letztlich ein Modernist geblieben ist und als solcher den perfekten Print liebt, davon abgesehen beschreibt er den Wechsel genau. Der Konzeptkünstler liebt die Idee und nicht das Objekt, er konzentriert sich auf das visuelle Denken und nicht auf das Ausarbeiten eines edlen Objekts, Bildidee und nicht Bild-Artefakt sind wichtig. Und die Fotografie wird eingesetzt wie eine Sprache: als Träger einer kulturellen Botschaft. „Bei konzeptueller Kunst ist die Idee oder die Konzeption der wichtigste Aspekt der Arbeit“, hielt Sol LeWitt fest, „wenn ein Künstler eine konzeptuelle Form von Kunst benutzt, heisst das, dass alle Pläne und Entscheidungen im Voraus erledigt werden und die Ausführung eine rein mechanische Angelegenheit ist. Die Idee wird zu einer Maschine, die die Kunst macht.“[13]
„The Pictures Generation“[14]
Während Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre die erste Generation der Konzeptkünstler am Werk war, formierte sich in den amerikanischen Colleges eine neue Generation. Sie ging seit der gleichnamigen Ausstellung 2009 im Metropolitan Museum in New York als „Pictures Generation“ in die Geschichte ein. Hierzu noch einmal John Szarkowsky. Er beschrieb das Phänomen in fotografischer Hinsicht so: „The addition of photography to the liberal-arts curriculum was a phenomenon particularly marked in the United States: in the three years between 1964 and 1967 the number of colleges and universities that offered at least one course in photography increased from 268 to 440. In Europe, in schools such as Hans Finsler’s Kunstgewerbeschule in Zurich and Otto Steinert’s Folkwangschule in Essen, pedagogical styles continued to emphasize a relatively rigorous concentration on conventional craft virtues, and students of photography were more likely to be educated with future commercial artists and graphic-arts specialists than with painters and traditional printmakers.”[15] Weiter führte er aus, in den USA sei die Kunstausbildung stark vom Gedankengut und Beispiel von Lászlo Moholy-Nagy beeinflusst gewesen. Eine bemerkenswerte Anzahl von Fotografie-Lehrern, die die neuen Lehrpläne der sechziger Jahre geschrieben haben, seien vormals Studenten des New Bauhaus, des Chicago Institute of Design, gewesen. Douglas Eklund, Kurator und Autor von „The Pictures Generation 1974-1984“, argumentierte in die gleiche Richtung: „The immediate trigger for the emergence of the Pictures group was the massive boom in college education during the late 1960s, which unleashed on the world huge numbers of artists, highly educated and trained professionally, in the 1970s.”[16] Studenten und Studentinnen seien durchs ganze Land gereist, um Schule für Schule zu testen. In dieser Zeit habe sich die Kunsterziehung komplett verändert, Studenten und Lehrer verstanden sich als gleichwertig, Colleges mussten „cutting edge“ sein. Das vielleicht eindrücklichste Beispiel ist die Gründung von CalArts, des California Institute of the Arts in Los Angeles, das 1970-71 mit finanzieller Unterstützung von Walt Disney startete. Der erste Direktor der Schule, Paul Brach, stellte gleich zu Beginn John Baldessari als Professor ein. Baldessari warf alle bisherigen Richtlinien über Bord: „You can’t teach art, that’s my premise …. We just eliminated grades. We had pass/fail. You can’t use grades as a punishment.“[17] Vor allem aber unterrichtete er die Studenten mit einem humoristischen Unterton über seine eigene Konzeptkunst, führte kleine failures als Thema ein (wie in „Aligning: Balls“ zum Beispiel), warf alle bisherigen ästhetischen und Haltungskriterien über Bord und lehrte seine Studenten, mit gefundenem Fotomaterial, mit Reproduktionen zu arbeiten: „I was very interested in found photography, and I could talk for hours about that.“[18]
Diese Generation dachte viel stärker vom gedruckten, gebrauchten, gefundenen Foto her als von der herkömmlichen Aussenwelt, der sogenannten Realität. Ihre Künstler waren auf der einen Seite Konsumenten der neuen Medienkultur, von Film und Fernsehen, Pop Musik und Magazinen, auf der anderen Seite waren sie an Roland Barthes, Michel Foucault, Julia Kristeva u.a. geschult und betrachteten genau diese Medienwelt mit cooler Distanz.[19] Die USA und der Rest der westlichen Welt wandelten sich gerade von einer Bedürfnis- zu einer Konsumgesellschaft und weiter zur Guy Debordschen „Société du spectacle“. d bringen die Künstler das Bild zurück in die Kunst, nach der fast ikonoklastischen Verweigerung des Bildes durch Minimal Art und Concept Art, aber sie verschieben den Blick vom Nach-draussen-in-die-Welt-Sehen hin zu Fragen wie: Wer hat dieses Bild mit welcher Absicht gemacht? Welche Ideologie verbirgt sich in dieser Darstellung? Wie handfest ist seine Bedeutung? So wie Identität nicht mehr als etwas Gewachsenes, Natürliches empfunden wurde, so wurde auch das Autokratische des Bildes, die behauptende Setzung, die scheinbar fraglos auftretende Bildidentität, grundsätzlich in Frage gestellt und mit Scharfsinn und Humor analysiert – und dann weiterverwertet.
Rauschenberg hat es als Erster praktiziert, in den späten siebziger Jahren wurde es allgemeine Praxis: die Aneignungskunst, die Appropriation Art, mit Robert Heinecken, Larry Sultan/Mike Mandel, mit Richard Prince, Sherrie Levine und in Europa mit Hans-Peter Feldmann und Chris Marclays Collagen von Schallplattenhüllen. Das Erstellen der Fotografie wird bei diesen Künstlern nebensächlich, die Aura des Künstlerischen ist unwichtig, vielmehr geht es darum, durch den Gebrauch der Fotografie Bilder zu untersuchen, den Begriff des Originalen zu unterlaufen, die Kontextabhängigkeit des Bildes, der Fotografie zu demonstrieren. Mit der Appropriation Art betreten wir sichtbar das Medienzeitalter der Kunst. Diese ersten Vertreter des Medienzeitalters bescheren uns aber auch grössere Dimensionen: Als wetteiferten sie mit den immer grösser werdenden Billboards im Strassenbild, wuchsen die gemalten und fotografierten Werke von Monat zu Monat. „Blow up“ wurde gleichsam zum Schlachtruf im Wettstreit der neuen Zeichenwelt.
Das Fremde im Eigenen – Back in Switzerland
1964 flatterten Peter Knapps 36 gefilmte und fotografierte Schweizer Fahnen an der Expo 64; 1969/70 thematisierten Balthasar Burkhard und Markus Raetz gemeinsam auf fünfzehn grossen Fotoleinwänden die Repräsentation als Objekt – Schwarzweissabbildungen von banalen, alltäglichen Dingen und Orten (das Atelier, die Küche, das Doppelbett, der Vorhang) wurden auf Leinwänden vergrössert und an zwei Klammern an der Wand befestigt –; Heinz Brand beschäftigte sich in seiner fotografisch angelegten Kunst von 1965 bis in die achtziger Jahre hinein mit der Relativität des Sehens, mit der Idee, der materiellen Wirklichkeit und ihrer beiden Repräsentation; Hugo Suter liess 1977 seinen „Oberflächentaucher“ in neun Teilen auf das Thema des Sehens, des Wahrnehmens los; Markus Raetz baute 1979 mit leicht zerknülltem weissem Papier einen kleinen Haufen und nannte die Polaroid-Aufnahme davon „Amsterdam, 2.4.79. Ein holländischer Schneeberg“; Gérald Minkoff schuf seine Instantfotochemogramme ohne Kamera, jeweils untertitelt mit „Nach ‚Rayogramm, Man Ray, 1923‘, 1978“ oder „Nach ‚Nude, Thomas Eakins, um 1880. The Metropolitan Museum of Art‘, 1978“, da es sich um zeichnerische Nachbildungen von berühmten Fotografien handelte, eingeprägt in sich entwickelnde Instantfotografien; und schliesslich tauchten Fischli Weiss 1979 erstmals mit ihrer berühmten Fotoreihe „Wurstserie“ auf, und Hannah Villiger begann ihre Körperstudien mit der SX-70-Polaroid-Kamera.
Diese Beispiele belegen, wie früh einige Künstler und Künstlerinnen auch in der Schweiz das konzeptuelle Denken aufgegriffen und als Methode eingesetzt haben. Das stimmt jedoch nur für die Kunstwelt, weit weniger für die Fotowelt. John Szarkowsky hatte mit seiner Einschätzung (weiter oben im Text) leider recht. Der Umgang mit der Fotografie in den siebziger Jahren hinkte in der Schweiz hinter den USA hinterher, weil sich die Fotoschulen deutlich langsamer der neuen Bilderwelt, der neuen Medienwelt entsprechend entwickelten. Von wenigen individuellen Ausnahmen abgesehen, verharrte die Fotowelt der Schweiz lange Zeit auf bekannten Feldern: auf der seit der fotografischen Moderne sachlichen exakten Dokumentation mit Fachkamera oder auf einer Reportagefotografie, die seit den siebziger Jahren mit stark körnigen, weitwinkligen Bildern mit schwarzem Rand operierte, aufgenommen mit 35mm-Kameras und oft auf das neue plastifizierte RC-Papier belichtet. Es dauerte bis weit in die achtziger, wenn nicht neunziger Jahre hinein, bis sich die Szene der Fotografen wirklich zu bewegen begann.
Zum Schluss drei Beispiele aus der Welt der Fotografie in der Schweiz, die früh den handelsüblichen Rahmen, die vorgefundene Welt- und Medienwirklichkeit hinter sich gelassen haben: Balthasar Burkhard, Hans Danuser und Robert Frank. Balthasar Burkhard hat, wie bereits erwähnt, sehr früh mit Markus Raetz zusammen fünfzehn grosse Leinwände produziert, darunter die vielleicht aufregendste, weil konsequenteste Arbeit: ein auf einem Holzboden aufgefaltetes weisses Leintuch wird fotografiert und das Resultat als grosses Fototuch an zwei Klammern aufgehängt. 1983 demonstrierte er in der Kunsthalle Basel neues fotografisches Sehen und Denken mit den „Fotowerken“, mit vergrösserten schwarzweissen Foto-Körper-Teilen, Knien, Armen, die teils wieder zu fast intakten, aber perspektivisch verschobenen fragmentierten Körpern zusammengestellt wurden.
Hans Danuser bewegte sich mit den sieben Teilen von „In Vivo“ in zwei Sonderzonen hinein. Einerseits betrat er mit den essayistischen Serien zu Goldraffinierung, Atomkraft, Pathologie, Chirurgie, Ronald Reagans Versuch eines „Kriegs der Sterne“ (Los Alamos), Tierversuchen und Gen-Technologie unheimliche Felder der Gesellschaft, Tabuzonen, in denen Wissen, Wert und Macht generiert wird. Andererseits betrat er mit seiner Fotografie, die er absichtlich in der bisher klassischen Formatgrösse hielt, eine bisher unerprobte Zwischenzone. Er bewegte sich wie eine reportierender, dokumentierender Fotograf in den beschriebenen Bereichen, anschliessend jedoch versah er mit alchemistischer (Labor-)Hand das Beschreibende, Deskriptive in seinen fotografischen Dokumenten mit einer hohen emotionalen Bildkraft, die die Betrachter bis heute zwingt, denkend und fühlend zugleich mitzugehen. Bei Danuser wandelte sich das Dokumentieren der Wirklichkeit in ein Angebot und eine Herausforderung des Betrachters. Der auch bei ihm wichtige Verweis auf die Wirklichkeit wird von der intensiven Spannung überlagert, die sich zwischen Bild und Betrachter herstellt. Wir befinden uns in einem düsteren Theater gesellschaftlicher Realitäten.
Es mag seltsam anmuten, Robert Frank, der einer früheren Generation entstammt und die Schweiz schon früh verlassen hat, hier an den Schluss zu stellen. Aber seine Arbeit erlaubt es, eine Position mit einzubeziehen, die im Kontext der hier angestrebten Betrachtung zu Unrecht übersehen werden könnte: Die radikale Subjektivierung des einst dokumentarischen Blicks. In einem Text zur subjektiven Fotografie schrieb ich über sein Werk: „[Frank] entwirft schliesslich (in den siebziger Jahren) in hoher autobiografischer Nähe mit Fotografie und Texten kleine Lebenssituationen, die von Heiterkeit bis zur Tragik, von Hoffnung zu Verzweiflung, von Liebe zu Verlust pendeln. In einer Tiefe, die uns bisweilen den Atem nimmt, in einer Unruhe – mit angerissenen Fotos, dunklem, auslaufendem Polaroid-Rand und kritzelnder, hektischer Schrift –, die den Pulsschlag der Aufregung spüren lässt, in einer Tragik manchmal, die alles in ihren düsteren, schwarzen Schlund zu schlucken scheint. Das Werk dieses Robert Franks keucht manchmal vor Verzweiflung, stösst sich immer wieder an der Sinnlosigkeit der Wirklichkeit, der Welt, kämpft mit ihrer Absurdität, sucht eigenen Sinn, findet Licht, verliert Menschen, kämpft gegen Resignation, verlangt aus der Nacht nach Licht, Glück, unbändig, schonungslos, dürstend, leidend.“[20] Diese radikale Subjektivierung schiebt Franks Fotografie in eine andere, performative, tagebuchartige Ebene, in der die gezeigte Wirklichkeit letztlich nur noch dienende Funktion hat: die Funktion, das Franksche Weltbild in ein oder mehrere Bilder zu fassen, zu „verkörpern“.
In diesem Sinn versteht auch die radikal subjektive Fotografie die Fotografie als ein Zeichen, das Zeichen einer Handlung, einer Befindlichkeit, und die Reihe, die Gruppe von Fotografien als eine Vernetzung von Zeichen, die zusammen einen visuellen Text ergeben. Die Vorstellung von Fotografie als direktes, „leibliches“, wahres Abbild der Wirklichkeit wurde auch hier radikal herausgefordert und verneint. Ab jetzt wird Fotografie neu gedacht und neu gebraucht.
[1] Siehe: Über Preise lässt sich reden. 100 Jahre Eidgenössischer Wettbewerb für freie Kunst. Hrsg. Bundesamt für Kultur. Bern/Zürich 1999, S. 330
[2] Gemäss Auskunft Hans Danuser
[3] Gemäss Auskunft von Walter Binder, Konservator der Schweizerischen Stiftung für die Photographie 1976-1998
[4] Das Begleitbuch – Urs Stahel/Martin Heller: Wichtige Bilder – Fotografie in der Schweiz, Zürich 1990 – enthielt einen sehr umfangreichen Aufsatz des Autors, der die Fotogeschichte der Schweiz von 1960-1990 aufarbeitete.
[5] Niklaus Flüeler: „Grösser als Magnum ist keine Photographie“, in: Weltwoche, Nr. 34, 24.8.1990, Seite 55
[6] Niklaus Flüeler, ebenda. Es lohnt sich, diesen Artikel in ganzer Länge zu lesen, weil er bewusst und unbewusst die damalige Situation sehr gut spiegelt.
[7] Walter Pfeiffer, in: Der Alltag, Nr. 1/1981, Titelblatt, S. 52-99, Umschlagrückseite
[8] Beat Wyss: „Nach der Moderne – die Schweiz z.B.“, in Kunstszenen heute, Ars Helvetica XII, Hrsg. Beat Wyss, Disentis 1992, S. 38
[9] Douglas Crimp: Über die Ruinen des Museums. Dresden/Basel 1996, S. 130
[10] Ernst, wie etwa die Prägungen von Filippo Tommaso Marinetti – „Der Futurismus beruht auf einer vollständigen Erneuerung der menschlichen Sensibilität“ – oder von Kasimir Malewitsch – „Im weiten Raum kosmischer Feiern errichte ich die weisse Welt der suprematistischen Gegenstandslosigkeit als Manifestation des befreiten Nichts“ –, oder von Max Bill – „Die konkrete Kunst (...) soll der Ausdruck des menschlichen Geistes sein, für den menschlichen Geist bestimmt, und sie sei von jener Schärfe und Eindeutigkeit, von jener Vollkommenheit, wie dies von Werken des menschlichen Geistes erwartet werden kann.“ Wie diese und viele andere Manifeste in der Kunst des 20. Jahrhunderts, so präsentierten sich auch die Bilder, und so wurden sie auch ‚vernommen’. Filippo Tommaso Marinetti, in: Umbro Appollonio: Der Futurismus, Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revolution, 1909-1918. Köln 1972, S.119ff; Kasimir Malewitsch: Die gegenstandslose Welt. Köln 1962, S. 194; Max Bill, zit. Nach Willy Rotzler: Konstruktive Konzepte. Zürich 1977, S. 130
[11] Beat Wyss, ebenda, S.38
[12] John Sarkowsky …..
[13] Sol LeWitt: „Paragraphen über konzeptuelle Kunst“, 1967, in: Über Kunst. Künstlertexte zum veränderten Kunstverständnis nach 1965. Hrsg. Gerd de Vries. Köln 1974, S. 177
[14] The Pictures Generation 1974-1984, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Metropolitan Museum of Art, New York 2009
[15] John Sarkowsky: Photography until now, New York 1989, S.269
[16] The Pictures Generation, ebenda, S. 22
[17] Ebenda, S. 23
[18] Ebenda, S. 24
[19] Ebenda, S. 17
[20] Urs Stahel: From Truth to Truthfulness (and from Pathos to System), in: Photography Vol. 3, From the Press to the Museum 1941-1980, Mailand, 2012, S. 17-18