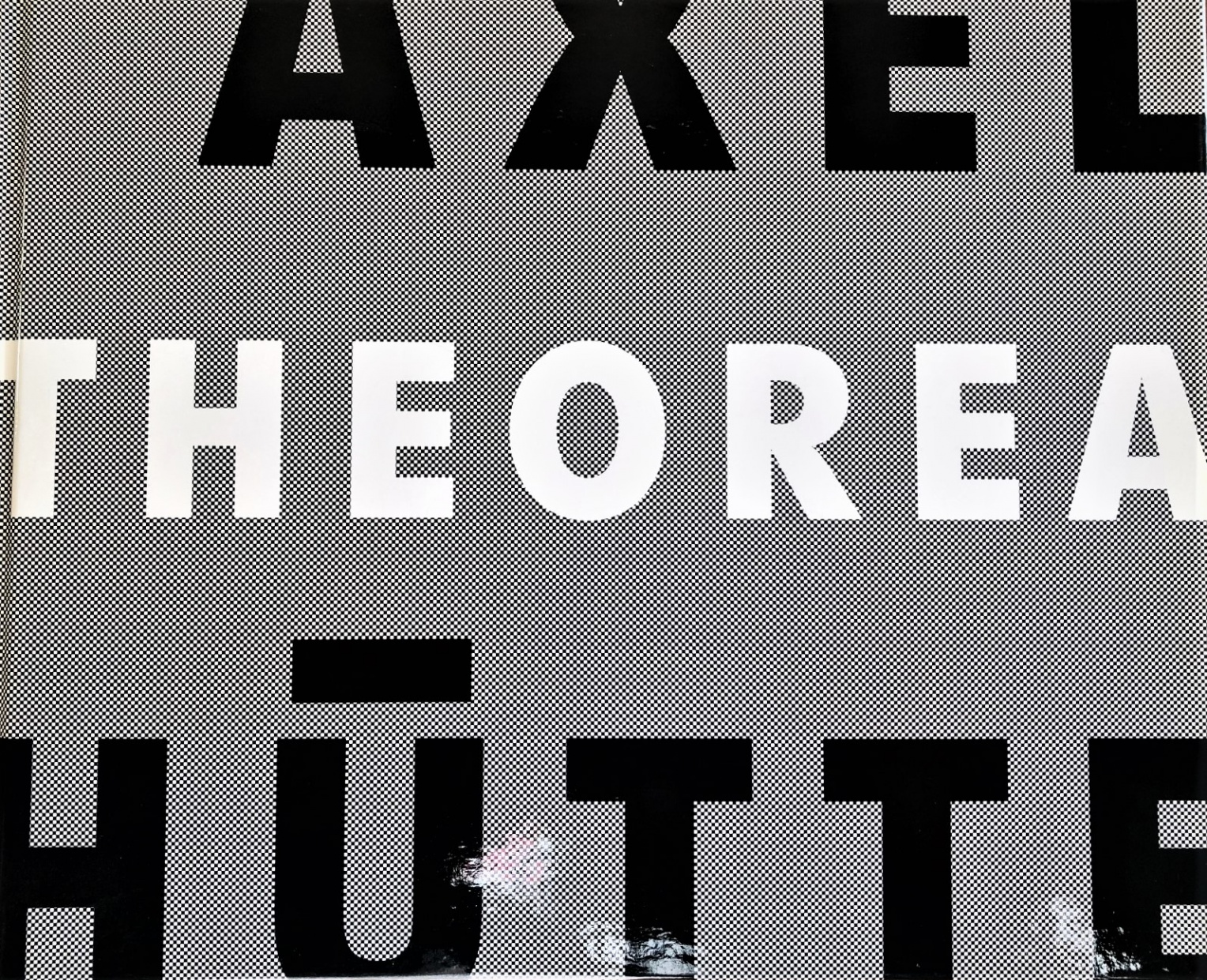Es beginnt in der Unterwelt – und es endet bei Nacht. Mit einem Bild der Unruhe setzt das Buch ein, mit Strassen, Wegen und Brücken, die sich ergänzen oder kreuzen. Obwohl die einzelne Linienführung klar und geordnet ist, entwickeln sich die Zeichen zum komplexen Geflecht, in dem Licht und Schatten zudem ein Eigenleben führen, sich querstellen, sich nicht den Formen anpassen. Ein grosses Irrlicht von rechts oben verleitet, auf einen Ausgang zu hoffen, doch der Weg führt weiter nach links, unweigerlich zur Zollgrenze, wie ein Schild zu lesen gibt. Licht und Architektur heben sich gegenseitig auf. Eine Hamburger Unterführung als Eingang zum Hades? Und die Bilderfolge schliesst bei grosser Ruhe, tiefer, mondloser Nacht, die kaum die Horizontlinie freigibt. Zwei, drei Kleinstlichter rechts unten, Lampen eines Weilers, und die Schatten von Häusern und Bäumen beheimaten und besänftigen damit den Blick. In erstem Fall ist der Raum vordergründig und dynamisch verflochten, im zweiten unendlich und ruhend.
Dazwischen steigen wir mehrmals auf und ab, erklimmen Anhöhen, den Parnass, erreichen die Alpen. Da lassen wir uns nieder, schauen hinaus, in die Weite, schauen hinab. Steigen dann hinunter, in die Ebene, in die Städte, unterqueren, untertunneln sie, um abermals anzusteigen. Dieser Weg lässt das Schattenreich der «Unterwelt» hinter sich: die Landschaft wird plastisch und farbig: blass, pastellig, zuweilen leuchtend; der Blick öffnet sich, ergiesst sich ins Land, versinkt in den Farben und Formen, fällt in die Weite; die Standpunkte der Betrachter wechseln, verlieren und finden sich wieder. Ein bisweilen lichtes, heiteres, bisweilen erhabenes, bisweilen brüskes Geflecht von Landschaften, von Blicken, Standpunkten, Farben, Texturen, und von Stimmungen spannt sich vom Anfang bis zum Ende, manchmal wirken die Bilder wie ein Musikstück intoniert und rhythmisiert, klassisch, romantisch, aber auch clusterartig oder minimal, in der Art zeitgenössischer E-Musik, manchmal fast wie ein Haiku konstruiert, da, einfach so: «Ich stehe am Rand eines Schneefeldes und schaue – den Schwaden des Nebels zu.»
Der Aufstieg aus der Unterwelt erfolgt stufenweise. Das zweite Bild zeigt den Ein- und Ausgang einer U-Bahn-Haltestelle. Beides ist gemeint, eine Grenzsituation, doch der Blick weicht vom schräg nach unten, ins Dunkle ziehenden Handlauf durch die halbtransparenten Scheibenmuster hin zur Oberwelt: Aufgang. Der Blick ist jedoch keineswegs freigegeben. Die Decke nimmt das Saugendschwarze des Treppenabsatzes auf, die Scheibenumrandung vervielfacht das Bild- und Architekturthema der Rahmung. Schemenhaft nehmen wir die Aussenwelt wahr, unterschiedlich diffus, je nach Struktur der Scheiben. Eine einzige klarsichtige Scheibe gibt drei, wiederum unterteilte Fenster an der gegenüberliegende Hausfassade frei. Ganz links ein Streifen Freiheit. Diese Grenzsituation wird durch den Kontrast von bläulichen, schwarzen und gelblich-beigen Farbtönen verstärkt.
Das dritte Bild verbarrikadiert den Blick. Wir sind jetzt draussen, aber eine blaugraue, wunderbar vernietete Eisenbrücke lenkt, rastert, ja versperrt den Blick. Gibt ihn nur gelenkt frei auf einen schwach begrünten Abhang und eine fallende weisse Linien von Leitplanken. Dahinter abgeschatteter, blaubraun ein Berghang, der sich nach rechts dem Sonnenschein zuneigt. Landschaft und Verkehr. Besetztes Land, besetztes Territorium. Die Brücke wirkt wie ein modernes Fort, dabei will sie nicht den Blick besetzen, vielmehr die Züge vor scharfen Seitenwinden schützen. Die Sperre im Vordergrund ist gleichzeitig so massiv und geordnet, dass sie Visier und Ziel, Rahmen und Thema wird, dass sie mit von der Verschachtelung der Landschaft erzählt.
Gleich daneben dann freier Atem, etwas gestockt durch den lastenden Dunst. Hier schauen wir in klassischer 19. Jahrhundert-Perspektive von einer leichten Anhöhe aus in die Landschaft hinunter. Wir stehen über dem Land, sind ihm enthoben und lassen uns denkend hinunter. Die Landschaft ist jedoch keineswegs unberührt, ist lange schon nicht mehr Natur. Der bräunlich-grüne Streifen zeigt Ackerbaulandschaft, viele kleine, parzellierte Felder, ein paar Häuser, Betriebe, ein paar Nebel das Land bedecken und die Sicht schliessen.
Vor uns eine grosse Ebene, bevor wir in die Berge steigen. Wir sind runtergestiegen, stehen mitten in der weiten, offenen Fläche. Es sind karge Winteräcker, braun, mit Resten von Schnee in den Furchen. Wir stehen mittendrin, doch das Bild flieht eigenartig, zieht sich zurück; Furchen und Strommasten laufen nach hinten links, ziehen den Blick mit sich. Als Gegenbewegung der leicht verschneite Hügelzug, der sich im Hintergrund von links nach rechts senkt, darüber wieder blasser Himmel, weissblauer Winter, ohne Regungen, scheinbar ewig in sich ruhend. Wir stehen in einer grossflächigen, industriell genutzten Landschaft Griechenlands, mit dem Gefühl der Unendlichkeit, wie für die russische Weite, und dem Gefühl der Gefährdung, wie in der Landschaft Stalkers.
Schliesslich sind wir in den Bergen, versetzen Caspar David Friedrichs Romantik in die Alpen. Ein Felsvorsprung und die unendliche Weite, unergründliche Tiefe. Ein dunkler, steiniger, mit wenig Grasnarben durchsetzter Absatz gibt dem Bild Boden. Da stehen wir, da steht das Bild. Geortet. Dann der Abgrund, die Unendlichkeit, Nebelschwaden, die sich dann und wann vor die teils schneebedeckten Bergwände schieben. Erschreckend schön. Erschreckend kontrastierend, zwischen dem klaren, dunklen, erdenden Boden, dem konkreten Hier, und der offenen, diffusen, lichten Weite, dem unerreichbaren Dort. Ein wunderbares «Gemälde» von weichen bis schärferen Weisstönen. Die romantische Seele (des einsamen Mönchs am Meer) erlebte zum erstenmal dieses Alleinsein, Alleinaufsichgestelltsein, dieses vom grossen Zusammenhang losgelöste Geworfensein. Der Existenzialismus hat dies ausformuliert. Knapp 200 Jahre später steht unsere Psyche noch immer am gleichen Ort, und erfährt, falls das Dröhnen des Alltags mal aufhört, das doppelte Erschrecken vor dem Alleinsein und vor der eigenen Grösse. Verlorenheit und Erhabenheit als eins. Grund fürs Bleiben, Grund fürs Springen – ins Nebelmeer. Der Entscheid liegt bei uns.
Axel Hütte thematisiert das Sehen, mal für mal. Er konstruiert fotografische Bildräume, in die wir, wie in die Guckkastenbühne des Theaters, hineinschauen, in die wir, verführt und gezogen, gedanklich eintreten. Wahl des Bildgegenstandes, Festlegung des Standortes und der Blickrichtung, Anordnung des Raumes und (Anordnung durch) Abwarten des natürlichen und künstlichen, immer aber vorhandenen Lichtes sind seine Koordinaten, seine Bausteine fürs Bild. Unterschiedliche Kombinationen dieser Elemente führen zu je anderen Seherlebnissen.
Die Bildräume sind auffallend rein, entleert, ge(schön)t gehalten, als dienten sie einer Abstraktheit, einer Idee, und doch wandeln sich die einzelnen (idealisierten) Sehvorrichtungen immer wieder zu Erlebnissen, Erfahrungen, zu Bestimmungen der Existenz. Dabei gebührt dem Gegenstand nur manchmal eine erhebende Wirkung, beispielsweise im Diptychon, das Axel Hütte vom Parnass in Griechenland hinunter aufs Meer gemacht hat. Dieser Ort ist einer jener schönsten Stellen, den Blick, den sie ermöglicht, einer der erhabensten, der grosses und tiefes Atmen und unbekümmertes, ruhiges Nachdenken erlaubt. Enthoben ohne Schrecken, Erhabenheit mit Gelassenheit. Währenddem das Bild mit dem Rhonegletscher den Betrachter herausfordert, die Felswand die Gefühle kräftig bewegt. Viele seiner Bildgegenstände sind dagegen banal, fast unbedeutend zeitgenössisch – ein Strassentunnel, eine U-Bahn-Haltestelle, der Blick über eine Stadt -, Mehrbedeutendes, ja Monumentalisierendes schleicht sich erst mit der Konstruktion ein. Den Gegenstand wählt Hütte mit dem Ziel des Bildraumes vor Augen, er stiehlt ihm quasi einen Teil seiner Autonomie, reinigt ihn vor zu grosser Eigenwertigkeit, entschlackt ihn zum Baustein im Forschungsspiel der Bedingungen von Wahrnehmung (der Realität).
Dem Betrachter wird eine von Bild zu Bild wechselnde, aber immer genaue Funktion zugeteilt. Fixiert bleibt dabei seine Position: Er steht mittelachsig vor dem Bild – vorstellen kann er sich, dass er im Bild steht, dass er herumwandert im Bild, vorstellen kann er sich, dass sein Blick frei ist, doch er wird angeleitet, selbst wenn das Blickfeld offen ist. Er befindet sich in einem lustvollen, sinnlichen Experimentierfeld.
Axel Hütte aktualisiert alte, hergebrachte und er schafft neue Seherfahrungen, Topoi des Sehens, der Raumerfahrung, der Mentalitäten- und Seelenlandschaften. Eine wichtige Unterstützung dafür ist das Mittel der Grösse der Fotografien. Wir schauen nicht auf die Fotografien herab, als kleine Abstraktionen der Realität, sondern sie treten auf uns zu, bauen sich uns gegenüber auf, physisch ebenbürtig oder grösser. Sie konkretisieren einen Raum, eine Situation. Die zwei Tunnelbilder zum Beispiel, das eine mit geführtem Blick nach links, ans Tageslicht, mit der leitenden «Licht»-Diagonale von rechts oben nach links unten, verbunden mit dem Gefühl des Durchfahrens, Durchmüssens; das andere mit schwach gelenktem Blick, der an der Nachtsituation draussen abprallt, zurückkkehrt und sich den Wänden entlang pirscht, die Ecken, die Rundungen, die Verzweigungen erkundet. Das Dunkel ist plötzlich nicht mehr Durchgangsszone, sondern Innenraum, architektonischer Bauch, der unterschiedliche Zonen, abgeschattete, hellerleuchtete, dunkle, aufweist: ein Aufenthaltsraum, der Schutz zu versprechen weiss. Der Blick sucht hier jede Ecke ab, und lässt sich dabei nicht ablenken.
Die beiden Londoner Architekturen als weitere Beispiele: unfarbene, beige-graue Bauten aus vorgefertigten Elementen. Sie formen eine Inversion, verwandeln den Aussenraum mit ihren Durchsichten in Innenräume. Sie cadrieren die Sicht, bieten gleichzeitig ein vielfältiges Spiel von Durchsichten, Ansichten – und haben Fenster, die Augen ähnlich zurückschauen. Verbaute, gefangene Welt: Ein beunruhigendes Spiegelkabinett, in der Form zeitgenössischen englischen Städtebaus.
Dagegen ein Nachtbild, das wie die Fotografie der U-Bahn-Station Alexander-Platz die Welt in die Bildfläche rückt, die Räumlichkeit durch ein Raster flachlegt. Das Nachtbild des Hafens mit seinen rasterartig aufscheinenden Lichtern und Widerscheinflächen, kleiner werdend gegen hinten, als würde sich die Bildebene zurücklehnen – das Alexander-Platz-Bild wie ein feingeteiltes Schau-Fenster – Hilfslinien fürs Sehen der Welt -, das die Aussen- zur Innenwelt werden lässt, das die Welt parallel vor den Augen aufteilt, in hier und draussen und hinter den Fassaden draussen.
Die beiden Aufsichten schliesslich, in die Verschachtelung eines Londoner Quartiers hinein. Wiederum stehen wir erhöht, doch es will sich keine Ruhe einstellen. Der Blick gleitet in ein Labyrinth von Bauten, rutscht ab, sieht sich irre an der Quadrierung der Quadrierung als Ornament. Die beiden Türme links und rechts dienen zum Anlehnen beim Schauen, wirken, paradoxerweise, wie die Erdung der Bilder, die Verankerung; wirken als Anhaltspunkt, als Ausweg aus der Klaustrophobie, bevor der Blick wieder ins Chaos abtaucht und wie ein Ping-Pong-Ball, wie eine Billardkugel von Wand zu Wand weitergelenkt wird.
Offener Blick, dagegen geführte, gegängelte, gerasterte, verbarrikadierte Blicke; weicher, wandernder, schmeichelnder Blick in der Ebene, der Weite, der Unendlicheit, dagegen der scharfe, suchende Blick im klar definierten Raum; der überlegene, enthobene, entrückte Blick gegenüber dem Mittendrinstehen, dem Auge-in-Auge-Gegenüberstehen; der Blick in die Tiefe, der Perspektive folgend, bis sie sich im Nichts auflöst, und der Blick an die Oberfläche, abtastend, undurchdringlich. Raumteiler, Sichtweichen, Sog und Blockade: Axel Hüttes Bildfindungen sind Sicht- und Emotionsbarometer, sie formen und vermessen den Blick, öffnen und schliessen das Sehen. Operativ gleichmässiges, abgeschattetes, temperiertes, kaltes Nacht- oder wärmendes Hauslicht unterstreichen die Temperatur des Raumes, des Sehfeldes, ebenso wie Schneeweiss, Himmelblauweiss, Landfarben und Nachtdunkel das Bild grundieren.
Bisher waren die Standpunkte immer nachvollziehbar, sogenannt normal, üblich, alltäglich, bis auf einige Bergbilder. In den neuen Diptychen hingegen, im Buch markiert ein winterfarbenes, staubiges Graubraun aus Italien den Anfang, ein Granitgrau, durchsetzt mit weissen Schneeflecken und nebliger Spitze folgt als zweites, dann dieses fast floreszierend grüne Diptychon eines moosverwachsenen Abhangs, schliesslich das Einzelbild eines Felshangs unterhalb des Rhonegletschers. Diese Bilder verschieben nun den Standpunkt – und mit ihm die Landschaft – ins Wilde, Ungewisse. Wir wissen nicht mehr, wo wir stehen; vor uns, als sei sie ein Teppich, der über die Klopfstange gelegt ist, die Landschaft, hochgezogen, gleichsam freischwebend; unten läuft sie, bodenlos, aus dem Bild raus. Landschaften, die deutlich in die Monochromie, die Farbfelder und Abstraktion tendieren, während gleichzeitig ihre Farbigkeit an Bedeutung gewinnt. Landschaften, welche die Orientierung freigeben, während sie als Bildform, als Ditpychon an Raumqualität, an Definition im Ausstellungsraum gewinnen. Landschaften, die ihre perspektivische Ordnung auflösen, dafür durch ihre leicht verschobene Duplizierung erstmals ein Zeitmoment einzufangen scheinen.
Diese Bilder formulieren und bestätigen neu, dass Kunst ein System parallel zur Natur ist, wie Cézanne es formuliert hat, auch wenn sie, wie die Fotografie, auf die Sichtbarkeit und die Ähnlichkeit in der Figuration angewiesen ist. Sie verwandeln die Landschaft von jeder Abbildhaftigkeit zu einem Bild als Konstruktion und gleichzeitig als Erlebnis, als Erregung. Sie verwandeln das Sehen in ein Abenteuer, in eine Fiktion, eine Schöpfung. Im Sehen erfahren wir Erhöhung, im Wahnehmen erfahren wir uns als Schöpfer, das scheinen diese Diptychen zu suggerieren. Der Schweizer Maler Michael Biberstein sprach von der «Apotheose des menschlichen Geistes im Sehen der Landschaft» und vom wandernden Auge: «Das Auge wandert in der Landschaft mit total entspanntem Blick, fixiert nirgends lange, die Peripherie des Blickfeldes ist ebenso präsent wie das Zentrum. Für einen Moment fallen das Ich und jenes, welches aufgenommen wird, zusammen…» Ruhige, leere, schweigende Landschaften, am Rande der Repräsentation auf der einen, am Rande zur Projektionsfläche auf der anderen Seite. Nicht in die perspektivische Unendlichkeit, sondern in die «Tiefe» der unendlichen (Ober-)Fläche gleitet der Blick, in die Tektonik, die Licht- und Schattenzonen der Bild-Landschaft. Wandernd schafft sich der Blick den eigenen Raum, schafft sich die eigene Landschaft.
Dann nochmals Sehschlitze, glitzernde Barrikaden, Visiere, die zur Zierde, zum Ziel der Betrachtung werden; Halblichter, Irrlichter, Sättigungen, Transparenz, Abschattung ins Weiche und Warme. Axel Hütte teilt die (Bilder-)Welt in Zonen ein, durch den Standpunkt, den Blick und die Raumkonstruktion. In Klimazonen, letztlich in Seelenlandschaften. Die letzten Bilder hier im Buch – mit rigidem, reduziertem Aufbau: Grund-Hintergrund, festigende und auflösende Farbe. Basta. – wechseln von japanischer, «buddhistischer» Schlichtheit, von gefüllter Leere, buschig-pelziger Kargheit zu romantischer Verlorenheit und zur Melancholie, der Kraft, die Spannung vom realen Hier zum fiktiven Dort auszuhalten, mit allen Konsequenzen. – Ein Ein-Sehen haben, am Ende eines Weges.