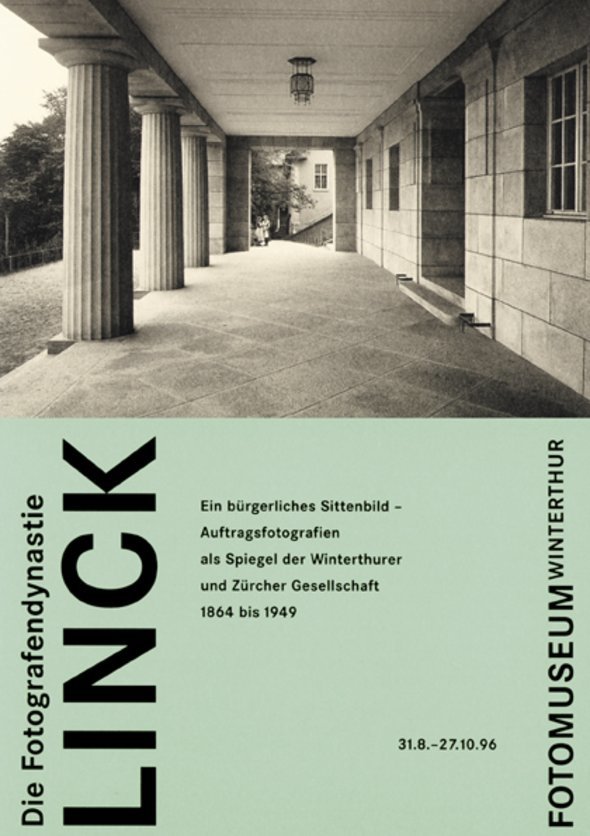Strassenzüge und Plätze haben die Lincks fotografiert, in Augenhöhe oder von leicht erhöhtem Standpunkt aus; Einzelhäuser haben sie aufgenommen, manchmal frontal, dann in raumgebendem Halbprofil oder aus einem Blickwinkel (und entsprechend geschiftetem Objektiv), dass die Hausecke gleichsam die Stirne, die Brust hochzog, sich jedenfalls markant ins Blickfeld schob und der Strassenzug sich perspektivisch verjüngend darbot; sie haben die Städte Winterthur und Zürich in Aufsicht präsentiert, nicht aus luftiger Höhe, nicht experimentell vom Ballon oder vom Flugzeug aus gesehen, sondern von der Anhöhe aus, vom Goldenberg in Winterthur, oder von der zentral gelegenen Sternwarte in Zürich, in der Philipp und Ernst Link eine Zeit lang ihr Atelier hatten. Villen, und davon haben sie einige fotografiert, wirken in ihren Fotografien stattlich, aber nur in ganz wenigen Fällen auftrumpfend, protzend - sonst sind sie eingebettet in den Park, in die Anordnung von Wegen, Büschen und Bäumen. Genauso «eingebettet» sind auch die Zimmer, die selbst dann, wenn die Fotografen das ganze Haus durchfotografiert haben - vom Salon über die Anrichte zum Schlafzimmer -, kaum etwas Privates preiszugeben scheinen. Sie haben institutionelle Bauten dokumentiert und von einigen dieser öffentlichen Gebäude - im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden vor allem Bezirksgebäude (Justiz), Schulen, Hochschulen, Spitäler und Museen gebaut - minutiös ein fotografisches Inventar angelegt: Totale der Anlage, Nahaufnahmen des Gebäudes von verschiedenen Seiten, Eingang, wichtige Architekturdetails, Treppenhäuser, Schulzimmer, Lehrerzimmer, Sammlung und Heizung. «Das ist es», «So sieht es aus», scheinen diese Fotografien zu sagen; Dokumente, manchmal fast ohne den Anschein von Repräsentation.
In gleicher ruhiger, sachlicher Weise haben sie in Industrie und Gewerbe fotografiert: Industriehallen von Sulzer, Rieter, Bühler Uzwil und von Bucher-Manz mit ihren Maschinen und Werkzeugen, die Bierbrauerei Haldengut vom Keller bis zum Dach, miteinbezogen den Firmenbesitzer hoch zu Ross, die Angestellten im firmeneigenen Bad und die Arbeiterchalets in der Umgebung. Sie haben Produkte aufgenommen: Zahnräder, Lokomotiven, heute merkwürdig, komisch, ja surreal wirkende Maschinen und Geräte aus der Dampfzeit oder dann Wandtafel-, Schiessscheiben- und Bücherregalsysteme der Firma Geilinger. Besonders viele Lokomotiven der heutigen SLM, meist gleichmässig ausgeleuchtet und streng von der Seite gesehen, als hätte es für so grosse Maschinen eine Art Märklin-Katalog gegeben. Industriehallen und ihre Produkte sind Elemente des Fortschritts im 19. und frühen 20. Jahrhundert, dennoch unterscheiden sich diese Fotografien nicht wesentlich von ihren Ansichten der Altstädte Zürichs und Winterthurs und den Einblicken in die Bürgervillen. Der Blick auf die Welt, die Dinge und die dadurch entstehende Bildordnung bleiben sich gleich, nur vereinzelt durchbricht ein Anflug von industrieller Monumentalität - wenn sich Zahnräder, kafkaesken Käfern gleich, in den Bild-Vordergrund wölben - den auffallenden Gleichmut der gezeigten Welt.
Die Menschen spielen in diesen Architektur-, Sach- und Industrie-Fotografien eine seltsame Rolle. Mehrheitlich fehlen sie, tauchen sie jedoch auf, dann nicht in jener Rolle, die sich das bürgerliche Individuum seit dem 19. Jahrhundert in zunehmendem Masse wünscht - eine souverän handelnde, bestimmende, würdevolle Position in der Verflechtung von Recht und Pflicht und Freiheit und Anerkennung -, sondern als Rädchen im Getriebe, als Teil des geordneten Ablaufs und als Grössenmass. Zuweilen noch als finales Mass - wenn in der Flucht eines Schulhauses Kinder auftauchen, am Ende der Veranda ein Paar steht oder kalenderartig, «spitzwegisch» aus allen Fenstern jemand hinausschaut, dann wird angedeutet, wofür das Gebaute steht. Diese Kleininszenierungen spiegeln aber auch ihre Lust zu gestalten. Die Menschen wandeln sich in den Linckschen Fotografien erst zu Individuen, wenn sie im Atelier auftauchen, wenn sie (zahlende) Kunden der Kategorien Einzelporträt, Paaraufnahme, Familienbild oder Kinderporträt sind. In mehrerer Hinsicht als Zwitter erscheint das Gruppenbild, etwa einer Studentenvereinigung, der Kadetten, einer Schulklasse, einer Firmenbelegschaft oder der Feuerwehr, vor allem aber von Vereinen, die vornehmlich im 19. Jahrhundert gegründet werden. Diese Bilder - meist vor repräsentativer Fassade, in Winterthur oft vor dem Technikum, in Zürich vor dem Landesmuseum aufgenommen - zeigen den Einzelnen eingebettet in einem Ganzen. Der Fotograf blendet gleichsam vor die gebaute eine temporäre Fassade aus Menschen, architektonisch gruppiert und strukturiert.
Im Studio erfährt das Individuum scheinbar seine volle Wertschätzung. Alles steht da plötzlich für es bereit - eine Balustrade, auf die es sich abstützen kann, ein Buch, das es in die Hand nehmen kann, eine gemalte Arkade oder eine geeignete Landschaft als Hintergrund, ein drapierter Vorhang, eine Fussstütze, schwere, kräftig geschnitzte Tische und Stühle im Second-Empire-Stil, sich rankende Pflanzen usw. -, ein Fundus an Requisiten, mit denen die Vorstellung eines individuellen Porträts Bildwirklichkeit werden soll. Den Blick nach rechts oder links oben gerichtet oder den Kopf leicht geneigt, alleine oder zu zweit, die Familie passend um den Vater herum gruppiert, so formiert sich im Atelier das bürgerliche Individuum und die bürgerliche Familie - ein personifizierbares Weltbild. Den Fotografierten war bei diesem Akt wohl nicht bewusst, dass sie den Augenblick der sich formenden Erscheinung von Individualität mit vielen anderen teilen, dass alle streng in die gleiche Richtung schauen, die Hand - «belesen» - auf demselben Buch abgestützt, vom gleichen Wunsch nach individueller Identifizierbarkeit und gesellschaftlicher Repräsentation beseelt. Wie sich beim Coiffeur Menschen verschiedenster Couleur treffen, so betraten die verschiedensten Schichten und Nachbarschaften - nacheinander - die Studios der Linck-Fotografen. Dennoch: es fehlen Arbeiterporträts, obwohl Hermann Linck in den Zeitungen «billigste Preise» versprochen hat.1
Diese Porträts entbehren nun auffallend der Sachlichkeit, welche die Industrie- und Architekturfotografien auszeichnen. Sie spielen Theater - weniger dasjenige auf der Bühne, als das im Foyer -, setzen in Szene, erzeugen eine Illusion. Die Linckschen Ateliers in Zürich und Winterthur waren Zauberbühnen, Illusionsmaschinerien. Der Blick auf die Person bleibt sich dabei im wesentlichen gleich, keine Auf- und Untersichten, aber den Kopf immer leicht über dem Kamerastandpunkt, so dass sich ein standesgemässes Kopf-, Brust, Kniebild oder gar eine Ganzaufnahme ergibt. Der Fotohistoriker Timm Starl schrieb allgemein zu dieser Form von Porträts im 19. Jahrhundert: «Im Atelier war der Bürger Souverän der Welt, die er nach seinem Geschmack ordnete und zugleich diesen als öffentlichen durchsetzte. Als ästhetisches Mittel diente ihm das Schema der Repräsentation, nach dem Personen und Gegenstände im Bild arrangiert wurden. Dies war die Fassade des Bürgertums, hinter der das wahre Gesicht des Alltags verborgen blieb.»2
Damit sind fast alle der hauptsächlichen Beschäftigungen der Linck-Fotografen angesprochen. Darüber hinaus haben sie manchmal Feste oder grosse Gewerbeausstellungen, einzelne Ereignisse - «Seegfrörni» in Zürich, der Brand eines Hauses, der Unfall eines Trams - dokumentiert. Dokumentiert, nicht reportiert, denn keiner der sechs Fotografen war je ein Berichterstatter, ein Fotoreporter.3 Es fehlen noch die Hinweise auf einzelne Spezialitäten, zum Beispiel, dass die Zürcher Lincks, die Firma Philipp&Ernst Link, viele Kunstwerke reproduzierten - ein wichtiger Einnahmezweig, der verständlicherweise keinen Eingang in den Bildteil des Buches findet -, dass Ernst Linck einige idyllisierende Landschaften und einzelne romantisierende «Süd»-Bilder - Architekturen und Landschaften in Italien - hinterlassen hat, dass Max Linck in seiner abstrahierenden Tendenz gefrorene Scheiben, Gewebeschnitte, Fischschuppen, Abfälle und Hans Linck präparierte Insekten fotografiert haben.
Die Lincks sind also - abgesehen von Differenzierungen von Person zu Person - zum einen Bildchronisten, wobei der Begriff Chronist eine entscheidende Bedeutungsveränderung erfährt: Sie sind nicht Chronisten von Ereignissen, sondern von Gegenständen; Chronisten der Bestückung der Welt, fotografische Vermesser der gebauten Welt. Und diese Chronistenarbeit scheinen sie so sachlich und neutral zu leisten, wie das bei der Reproduktion eines Kunstwerkes Voraussetzung ist. Sie sind zum anderen aber auch Bildinszenatoren. Beim Porträtieren leisten sie Schützenhilfe, weichen sie ab von der Sachlichkeit zugunsten eines In-Szene-Setzens, werden sie zu genau kalkulierenden Choreographen.
Diese Sachlichkeit auf der einen Seite und das Illusionäre auf der anderen Seite soll nun genauer betrachtet werden, geleitet von der Frage nach dem darin enthaltenen Wirklichkeitsentwurf - mit einem kleinen Exkurs in die Kinderporträts. Blättert man durch die Bildwelt der Linck-Fotografen, immer und immer wieder, dann erweckt sie schliesslich die Vorstellung einer viktorianischen Zeit, das heisst auf der einen Seite einer krisen- und kriegsfreien, offiziell also einer leidensfreien Zeit und auf der anderen Seite einer eher unsinnlichen, körperlosen Zeit.4 Eine viktorianische Ära in der Schweiz von 1870 bis 1950, in der Streiks, Kriege und Armut ebenso ausgeklammert sind, wie die grossen Begriffe Glück, Trauer und Freude. General Wille, stolz uniformiert vor einer Villa, ein Paar Porträts von Soldaten der Bourbaki-Armee, Brennmaterial-Ausgabestellen, Kartoffeläcker vor Villen sind die seltenen, fast anekdotischen Einsprengsel aus einer «anderen», einer von Nöten gezeichneten Welt - in einem homogenen Weltbild, das über 80 Jahre Zürich und Winterthur als geordnet, gepflegt, sicher und beständig und deren Bürger als still und zufrieden zeigt.
Mehr noch als die Absenz bestimmter Motive ist es die Bildauffassung, die diesen Eindruck erweckt. 1870 bis 1920 findet in der Schweiz der zweite grosse Schub der Industrialisierung statt. Es ist wirtschaftlich, wissenschaftlich und politisch die Zeit des Fortschritts, des «Alles ist möglich», des «Wir erobern die Welt», mit der grossen Zäsur des Ersten Weltkrieges; regionalpolitisch gesehen ist es die Zeit des Kampfes zwischen Zürich und Winterthur um politische und wirtschaftliche Vorherrschaft, zwischen den Liberalen und der «Demokratischen Bewegung»; es ist auch die Zeit des Eisenbahnbaus in der Schweiz; in der Kunst finden die schnellen Wechsel von Impressionismus (in der Schweiz vom Historienbild) zu Symbolismus, Fauve, Expressionismus und Abstraktion statt, in der Fotografie die Wechsel von einer bestandesaufnehmenden Abbild-Fotografie im 19. Jahrhundert zur bildmässigen Fotografie des Pictorialismus und zum expressiven Neuen Sehen. Von all dem, all diesen teils heftigen Entwicklungen ist in den Industrie- und Stadtfotografien der Lincks nur wenig zu spüren. Lokomotiven gibt es zwar zuhauf, aber sie bewegen sich nicht, Brücken sind von ferne, nicht in dramatisierender Aufsicht fotografiert, kaum je sieht man qualmende Fabrikschlote, keine schwarzen Wände in den Fabriken. Stattdessen zeigen die Architektur- und Stadtfotografien eine lichte, geschäftige, nüchterne Welt. Mit auffallend präzis gewähltem Standpunkt und Bildausschnitt, mit sorgfältig gelegter Schärfeebene werden Häuser und Strassenecken aufgenommen und dann in dichten, gut durchzeichnenden Abzügen wiedergegeben. Standpunkt und Bildausschnitt sind präzis, gekonnt, aber selten «mehrbedeutend» oder extravagant gewählt: «Normalsicht» wird angestrebt. Die Abzüge sind meist gut bis perfekt, aber nie expressiv in den Hell-Dunkel-Werten. Wie vom Motiv her das Dunkle, das Unreine, Beunruhigende, die Not (auch die Nacht) oder, allgemeiner, alles Heftige, Romantische, alles Körperliche vermieden wird, so auch in der Gestaltung.
Es geht nicht um eine persönliche, subjektive Darstellung, nicht darum, ein Symbol für den angeführten Wechsel der Zeiten zu schaffen, es soll, dem Auftrag entsprechend, eine scharfe, nüchterne und detailreiche Bestandesaufnahme entstehen. In der Malerei würde man von einer Vedute, ja vom Prospekt (etwa in den Fabrikstichen) reden, von einer Darstellung, in der die Sachlichkeit vor allem Malerischen steht. Durch das Weglassen alles Störenden, alles Schmutzigen erfährt diese Sachlichkeit eine Idealisierung, nicht in einem absoluten, sondern im pragmatisch-bürgerlichen Sinne des 19. Jahrhunderts. In den Fotografien - ob sie nun eine Villa, eine Industriehalle, das Bezirksgebäude, die Schulen zeigen - wird immer akribisch, enzyklopädisch das Vorhandene gezeigt, wird die Welt, das heisst, die Errungenschaft, das Gebaute, Geleistete, Geäufnete vorgeführt. Diese fast pedantische Sachlichkeit der Linck-Fotografien wirkt wie ein perfektes Spiegelbild der mittelständisch-biedermeierlichen oder der geldbürgerlichen Welt; sie verleitet zum Begriff des Puritanisch-Protestantischen. In den Fotografien bietet sich die Welt als überschaubarer, geordneter Kosmos an - der diesem oder jenem gehört. Der Standpunkt und die Bildordnung vermitteln Übersicht und Detailsicht in einem, die Perspektive schliesst das Bild, rundet die Welt, alle Mittel zusammen zeigen die Welt als das Naheliegende, Vertraute und Massvolle, jedoch nicht das Unbekannte, Bedrohliche - und dazu gehören auch die Sinne, das Körperliche. Erstaunlich eigentlich für eine parallel zu den deutschen Gründerjahren wachstumseuphorischen Zeit. Aber: «Die Gesellschaft war in ein Stadium der Nüchternheit getreten, wo der Spielraum für Poesie verschwand. (…) Die Welt musste jetzt begrifflich erklärt werden mit dem Grau des vernünftigen Gedankens.»5 Begrifflich erklärt, wissenschaftlich erforscht und wirtschaftlich genutzt werden.
Hier muss betont werden: Alle diese Fotografien sind Auftragsfotografien. Die Lincks fotografierten kaum je ohne Auftrag. Sie waren im besten Sinne Gewerbetreibende, die ihre Leidenschaft in der Perfektion auslebten. Die Übereinstimmung - und das ist eine der Qualitäten der Linck-Fotografien - von Motiv und Darstellung, lässt auf eine grosse Übereinstimmung, ja eine Form von Identität zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schliessen. Die Fotografien versuchen nicht, quer zum Auftrag eine neue Sicht zu ermöglichen oder die Szene diskursiv darzustellen, vielmehr bestätigen sie den Kontext, in dem sie entstehen. Für Johann und seinen Sohn Hermann Linck und den Cousin Philipp Link darf wohl als kennzeichnend angeführt werden, dass sie als arme Zuwanderer sich durch das perfekte Ausführen der Aufträge den Zugang zum Bürgertum erworben haben. Für die Auftraggeber waren es besitzanzeigende Fotografien, für die Auftragnehmer Aufstiegsfotografien. Diese Bescheidung öffnet sich erst mit dem Motiv oder den Auftraggebern: Architektur von Rittmeyer&Furrer zum Beispiel wird monumentaler, Lux-Guyer-Architektur neusachlicher fotografiert. Bei aller Einheitlichkeit, die durch den Auftrag vorgegeben ist, gilt diese Beschreibung vor allem für Johann und Hermann Linck, für Philipp und teils für Ernst Link. Doch Ernst Link unterläuft die Strenge der Architekturaufnahmen bisweilen mit seinem Hang zur Idylle. Blätter, die von oben ins Bild ragen, ein blühender Busch im Vordergrund, ein Haus bei Schnee fotografiert, lassen die Sachlichkeit zurücktreten. Max Linck betont das Strenge, Reduktionistische im Sinne einer künstlerischen Neusachlichkeit - fast entfunktionalisiert er die Gegenstände in seinen eindrücklichen Versuchen der bildmässigen Konkretion -, Hans Linck fotografiert zu heterogen, um in eine generelle Charakterisierung zu passen. Vielleicht können sein teilweises Scheitern in der Auftragsfotografie6 - nie aber beim Fotografien seiner Frau - und sein Scheitern im Leben als misslungene Versuche des Ausbruchs aus der Dominanz des Vaters, der Fotografie, des Bürgertums gedeutet werden.
Diese Charakterisierung der Linckschen Fotografie läuft Gefahr, die bisweilen überragende Qualität der Fotografien zu schmälern. Die Genauigkeit, Sorgfalt und das Einfühlungsvermögen in die Struktur von so unterschiedlichen Architekturen wie einer Bierbrauerei, dem Kunstmuseum Winterthur, den Schulhäusern, Bezirksgebäuden, den Gaswerken in Zürich und Winterthur und den vielen Villen und Parks in der Gartenstadt Winterthur sind herausragend. Oft entstehen Bilder, die in ihrer Zuspitzung des sachlich Vorhandenen auf das funktional Wesentliche den Rahmen «Auftragsfotografie» sprengen - ohne den Auftrag zu vernachlässigen. Einzelne Fotografien von Turnhallen, Treppenhäuser, Fassadenansichten und Pärken sind, fast paradox, in der Steigerung innerhalb eines klar abgesteckten Rahmens ausser-ordentlich.
Der gleiche Auftraggeber nun, der seinen Besitzstand - dem positivistischen, rationalistischen Geist der Zeit entsprechend - nüchtern dokumentiert haben will, möchte im Atelier mit allen Insignien der vorbürgerlichen Zeit, des Ancien Régimes ausgestattet werden. In der Produktion und dem Handel fortschrittlich, schnell, erfolgreich, im Privaten wertkonservativ: das sind Kennzeichen des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Die «Entzauberung der Welt»7 wird im Atelier aufgehoben. «In der Portraitmalerei herrscht noch ein Laster, in welchem manche Nation ganz und gar befangen ist. Selten sind diejenigen, die sich damit begnügen, einfach zu portraitieren oder sich so portraitieren zu lassen, wie sie Gott geschaffen hat. Vielmehr muss man eine Pose einnehme, die angeblich geistreich sein soll, ohne dass man wüsste warum. Augen, Mund und Hände müssen gemäss der Vorstellung, die man sich von diesem veflixten Geist zurechtgesponnen hat, gespreizt und nochmals gespreizt sein; und indem man den Körper in entgegengesetzter Richtung perspektivisch verkürzt oder verdreht und sowohl Taille als auch Kopf nach hinten wirft, ahmt man die Haltung von Tänzern nach. Man tut mithin alles Mögliche, ein Porträt lügen zu lassen…»8 Zutreffender als Anton Raphael Meng 1780 könnte man das fotografische Auftragsporträt hundert Jahre später nicht schildern. Der Bürger will, selbst gegen Ende des Jahrhunderts und ganz entgegen dem Fortschritt des Denkens, der Wissenschaften - Stichwort ist die Indizienforschung als Erkennungsmethode: in der Psychonanalyse, der Kunstwissenschaft, dem Kriminalroman, der Kriminalistik (Beispiel: Fingerabdrücke) - und entgegen der Individualisierung der Gesellschaft nicht ein «authentisches», individuelles, sondern lange noch ein «typisches»9 Porträt mit nach Hause nehmen. Im Gegensatz zur Malerei und Bildhauerei in früheren Jahrhunderten - wer weiss schon nach hundert Jahren, wie jemand ausgesehen hat -, war eine Ähnlichkeit mit der Person durch die fotografische Aufzeichnung jedoch immer schon gegeben. Die Typisierung erfolgte dann - sie bezieht sich immer auf den nächsthöheren Stand, ist also auch Stilisierung - in der Art italienischer und französischer Malerei des 18. Jahrhunderts, und sie meinte: Ich bin und ich habe. Johann Linck und sein Neffe Philipp Link haben sich ganz dieser standesgemässen Typisierung verschrieben. Ihren guten Porträts gelingt es aber gleichwohl, die abgebildete Person offiziell wirken zu lassen, ohne sie zu entpersönlichen. Die Brüder Hermann und Ernst gehen dann einen Schritt weiter. Die Winterthurer Porträts von Hermann Linck bestechen durch ihre Reduktion aufs Brustbild. Die Requisiten fallen meist weg, es bleibt die Person, die nun lediglich durch ihre Haltung, ihren Ausdruck sich selbst und ihre Position, ihre Machtfülle wiedergibt. Die Porträts wirken nüchtern, ja karg und streng - ihrerseits nun eher der Art deutscher (Holbein) und niederländischer (Frans Hals) Porträtskunst verwandt. Diese Fotografien sind Spiegel-, ja Sinnbilder des bürgerlichen Bewusstseins von Souveränität, Individualität und Macht. Mit fünfzig bis siebzig Jahren Verspätung akzeptiert der Bürger schliesslich in solchen Fotografien das seiner wirtschaftlichen und politischen Macht und seiner Vorstellung der eigenen Person auch gestalterisch angemessene Porträt. Das Illusionistische weicht schliesslich einer puristischen Strenge, die der (idealisierten) Sachlichkeit der Architektur- und Industriefotografien entspricht. Die Strenge von Hermann findet sich bei Ernst Linck, soweit die Fotografien eindeutig zuzuordnen sind, nicht in gleichem Masse. Seine Porträts liebäugeln vielmehr mit einer sinnlicheren, in Einzelfällen auch etwas süsslichen Form des Porträts all' italiana. Max und Hans Lincks Porträts berühren beide, wenn auch sehr unterschiedlich, Bildvorstellungen des Films der dreissiger Jahre; die Porträts von Max erstaunlicherweise, trotz seiner sonst neusachlichen Haltung, Filme mit expressivem Hintergrund, jene von Hans, der das Glück suchte, amerikanische Familienfilme dieser Zeit.
Dieses «Wir sind und wir haben», das sich in den Architektur- und den Porträtfotos je unterschiedlich manifestiert, verbindet sich in den Familienbildern zu einem Ganzen. Es finden sich eindrückliche Familienbilder, die, falls vorhanden, im eigenen Garten, auf der Terrasse oder vor der Fassade des eigenen Hauses aufgenommen wurden und vom Motiv und der Gestaltung her den Kreis des bürgerlichen Weltbildes
schliessen.
Der homogene, nur wenig sich entwickelnde Weltentwurf - es ist übrigens ein auffallend regional-liberal-wirtschaftlicher Prospekt, es findet sich überhaupt kein nationales, kein Heimatgesäusel in den Fotografien -, wird, abgesehen von den privaten Fotografien10, von einer Kategorie aufgebrochen: den Kinderfotografien. Wohl unbeabsichtigt, aber nicht grundlos. Das 19. Jahrhundert kultiviert die Familie und mit ihr das Kind. Doch der Fotograf ist noch nicht für die Kinder eingerichtet, das Mobiliar im Studio nur für Erwachsene gedacht.11 Also stehen die Kleinkinder auf Kommoden, als würden sie gleich herunterfallen, also versinken sie in zu grossen Stühlen, schauen mit grossem, schwerem Kopf und seltsam gebrochenem Blick in die Kamera.12 Je kleiner die Kinder, desto stärker verrutscht die Ordnung, desto weniger sozialisiert erscheinen sie. Bisweilen wirken sie wie kleine Monster, wie nicht sozialisierte Wichte, enfants sauvages, wie Findelkinder, die sich ins bürgerliche Intérieur gewagt haben. Manchmal sind sie kleine fremde Wesen, die aus tiefliegenden wehmütigen Augen eine grossartige Verlorenheit ausstrahlen. Ihre Einkleidung - in eine Tracht, ins Hemdchen «Mädchen vom Lande», ins Prinzessinnenkleid, in eine Uniform mit Peitsche, in ein Clown- oder Matrosen-Gewand - verstärkt das Absurde. Diese Porträts wirken, weil sie im vorgesehenen Sinne eigentlich scheitern, weil sie nicht ins Muster, in die vorgegebene Ordnung passen, bedrohlich oder lieblich, komisch oder poetisch und immer privat und direkt und verletzlich - sie werden zu seltsam packenden Fotografien. Je älter die Kinder jedoch sind, desto besser passen sie wieder ins Gefüge, in die Vorstellung von spielenden Kindern oder von heranwachsenden Jünglingen und Mädchen, von Stammhaltern der Familie und des bürgerlichen Weltbildes.
Jede Abbildung ist auch Inszenierung von Wirklichkeit, ist Weltentwurf, jede Inszenierung auch Spiegelbild, auch Repräsentation der in der Wirklichkeit eingeschriebenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das führen die Linck-Fotografien in einer oft aussergewöhnlichen fotografischen Qualität vor. Diese Wirklichkeit bleibt homogen, so lange auch die eigene Familie intakt bleibt. Nach der Scheidung von Hans Linck wird erstmals Gebrochenheit spürbar. Offenbar schien für ihn der Weg aussichtslos. Mit seinem selbstgewählten Tod 1949 endet der Winterthurer Zweig der Linck-Fotografen. In Zürich übernimmt Max zwar das Atelier von Philipp Lincks Erben, aber er entwickelt zunehmend eine künstlerische Haltung - neusachlich reduzierend -, die wohl schliesslich Auftragsarbeiten im gewohnten, beschriebenen Sinne verunmöglicht.