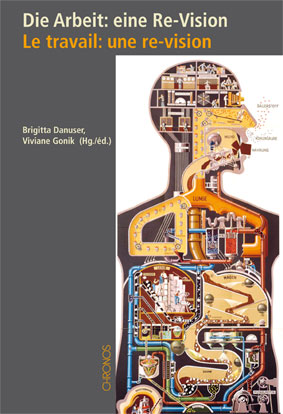„Wir verschalen, verkleiden, drapieren, lackieren, decken gerne ab und zu – die schiefe Wand, das alternde Gesicht, die ausbrechende Bohrstelle, die verbeulte Karosserie. Wir arrangieren unsere Welt gerne so, dass ihre Entstehung, ihr Mechanismus, ihr Operieren nicht mehr sichtbar sind, dass sie wie eine perfekte glänzende Box vor uns hingestellt, betrachtet und bewundert werden kann. Handlungen verschwinden im Resultat, Ausrisse, Mängel und Fehlhandlungen werden kaschiert, Leerstellen wegeditiert – oder es wird, eine alte Schlaumeierei, aus neun von zwölf Kuchenstücken wieder ein perfekter Kreis, ein neues Ganzes arrangiert. Wir mögen das Resultat, den Auftritt, die Aktion, das Event und den Glanz – und retuschieren das Dazwischen, das Abwesende, Matte, den Antiklimax weg, wischen das Unerwünschte in den realen oder virtuellen Papierkorb. So besteht unser Bild der Welt oft aus lauter Bühnenauftritten, aus erfolgreichen Handlungen, aus Präsenz und Glanz, während Leerstellen – das Warten, Nichtgeschehen, die Langeweile – unter den Tisch fallen. In Abwehr des Horror Vacui pumpen wir pausenlos, wie eine Getränkeabfüllanlage im 24-Stunden-Betrieb, Ereignisse, Aufmerksamkeiten in unsere Welt.“ Diese Zeilen schrieb ich neulich anderem Zusammenhang. Hier sind sie zu ergänzen mit: Und wir verbergen oft mit allen Mitteln den Aufwand, den wir dafür betreiben, die Arbeit, die dahintersteckt, die Ausbeutung, die damit verbunden sein kann.
Die Arbeit hat ein Kreuz mit ihrer Sichtbarkeit. Mal soll sie sichtbar, mal unsichtbar sein, mal soll ein Teil davon möglichst grell sein, nur um andere Teile umso besser verdecken zu können. Sichtbarkeit ist oft ein (letztes) klassenunterscheidendes Merkmal. Schwielen an den Händen sind ein Zeichen von Handarbeit, von Bauarbeit oder von Fabrikarbeit. Ein Zeichen, das auch in der heutigen Gesellschaft kennzeichnend und ausgrenzend wirkt. Das blütenweisse Hemd des Bankers, der perfekte Haarschnitt, das fast pudertrockene Gesicht hingegen funktionieren nach dem Prinzip der Sichtbarkeit der Unsichtbarkeit. Das Outfit ist Zeichen dafür, dass alles klar und bestimmt ist, dass wir alles im Griff haben. Doch nicht immer wird Arbeit nur versteckt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als Harald Szeemann den amerikanischen Maler Cy Twombly im Kunsthaus Zürich ausgestellt hat. Damals, 1987, war ich als Kunstkritiker unterwegs und sah, wie Twombly im perfekten dunkelblauen, Nadelstreifen-Anzug aus seinem Römer Domizil in Zürich ankam. An der Eröffnung jedoch trug er einen „Künstleranzug“: Er trat im Pullover und im leicht verwaschenen Bauarbeiter-Overall auf. Sein Künstlerdasein wurde offensichtlich, wurde als Look vorgestellt. Der Brioni-Anzug blieb im Hotel. Das Künstlerdasein ist salonfähig, das Bauarbeiterdasein weniger.
Unterschiedliche Felder und Gründe für (Un-)Sichtbarkeiten bestimmen das Feld der Arbeit und seiner Darstellung, der realen oder der fotografischen Darstellung. Drei Formen davon sollen näher angeschaut werden: 1. Die Sichtbarkeiten im Feld der frühen Industriefotografie am Anfang des 20. Jahrhunderts. 2. Die Sichtbarkeit körperlicher Arbeit in der Reportagefotografie seit den fünfziger Jahren. Und 3. das Thema der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im Feld der Dienstleistungsarbeit und der Roboterarbeit heute.
1.
Für eine Fotografie, der wir grosse Realitätsnähe und präzise Sichtbarmachung zuschreiben, benutzen wir Begriffe wie „dokumentarisch“, „sachlich“, „neutral“ oder „objektivierend“. Die Industriefotografie, die in der Vergangenheit mit viel Aufwand und Genauigkeit sachliche Sichtbarmachung betrieben hat, ist das perfekte Beispiel dafür. Gerade weil die Industriefotografie so präzis, aber auch so vielfältig war, galt die Ausbildung zum Fotografen eines grossen Industriebetriebs einst als umfassendste und interessanteste. Der Industriefotograf porträtierte zum Beispiel Arbeiter und Angestellte beim Eintritt und beim Austritt, also bei der Pensionierung. Er hatte Laufspuren und Gussfehler zu dokumentieren, also Material fotografisch zu prüfen. Er sollte einen einfachen, kleinen Gegenstand so perfekt ausgeleuchtet aufnehmen können, dass erkennbar war, aus welchem Material er geschaffen und wie er modelliert war. Das Gleiche musste ihm im Grossen gelingen, wenn er ein Zahnrad von 10 bis 14 Metern Durchmesser aufzunehmen hatte. Er wurde zum Architekturfotografen, wenn es galt, die riesigen Fabrikhallen von innen und aussen zu fotografieren. Offensichtlich stand er im Dienste verschiedener Sichtbarmachungen, registrierte, prüfte Material, übte Abläufe ein, kommunizierte und repräsentierte die Errungenschaften der Firma, die Produkte als eine Art vom Himmel gefallene Objekte, vor weissem Hintergrund, losgelöst aus dem Produktionszusammenhang.
Was immer er auch fotografierte, der Industriefotograf hatte sich, wie vielleicht in keinem anderen Feld der Fotografie, strikt an ganz bestimmte Richtlinien zu halten: Feinkörnig sollte die Fotografie sein; das Licht sollte die Tonwerte ausgeglichen und nachvollziehbar machen; Schärfe sollte das ganze Bildfeld überziehen, und alle Objekte waren möglichst unverzerrt wiederzugeben! Diese vier Elemente wurden zum Credo des Industriefotografen. Um das zu erreichen, wusste er genauestens Bescheid über alles Filmmaterial, setzte Scheinwerfer, Spiegel, weisses Papier ein, um die Werkstücke ins richtige Licht zu setzen. Störten Glanzlichter wurden die Metallteile abmattiert. Beim Entwickeln des Films, beim allfälligen Umkopieren wurde ausgeglichen, abgeschwächt oder verstärkt, später mit dem Schabemesser oder mit sehr weichem Bleistift das Negativ retuschiert. Es wurde so lange retuschiert, bis die gewünschte Brillanz, Dichte, die Durchzeichnung der hellen wie der dunklen Partien erreicht waren.
Um die gewünschte Sachlichkeit und Sichtbarkeit, eine gut durchzeichnende, scharfe und materialgerechte Wiedergabe zu erreichen, wurden also fast sämtliche Tricks der Fototechnik angewandt. Um die Neutralität der Objektwiedergabe zu erzeugen, wurde nach allen Regeln an der Fotografie „herumgedoktert". Fazit: Wir stehen vor einem Paradox. Es ging in der eigentlich sachlichen Industriefotografie offenbar nicht um einfache, dokumentarische Sichtbarmachung, sondern um aufwendige Bild-Konstruktionen. Ob ein Gegenstand vor weissem Hintergrund fast magisch fotografiert, eine Werkhalle mit glänzenden Maschinenteilen zum Schauplatz der Moderne stilisiert wird, oder ob eine Reihe von Arbeitern beim Schweissen von Werkteilen wirken, als treten sie im Theaterstück „Autogenschweissen im Dreivierteltakt“ auf die Bühne: Immer wurde inszeniert, arrangiert und dann nach langer Vorbereitung ausgelöst. Das Foto wurde dabei als Ereignis, als Produktion verstanden. Es wird zum „Industrie-Standbild", zum Stillleben, ähnlich dem Film Still eines Hollywoodfilmes.
Ziel und Überzeugung blieben aber immer die Sachlichkeit, das sachliche Sichtbarmachen. Sie war fest im Selbstverständnis des Fotografen verankert. Auch wenn die Sachlichkeit mit der Zeit ihre scheinbare Wertfreiheit verliert und zu einer Art „corporate identity“ der gesamten Industrie wird. Das fotografische Bild liefert das „Bild“, das die Industrie von sich geben will. Es deckt sich perfekt mit der Vorstellung des Technischen, Mechanischen, Präzisen und Sauberen in der Industrie. Es vermeidet das Düstere und Russige, das Schmutzige und Schweissige, lässt die Industrie immer leichter, heiterer erscheinen, als sie es je gewesen ist – eine Vielzahl an riesigen Magnesiumscheinwerfern sorgte lichtstark dafür –, und es vermeidet jedes expressive Moment und dadurch ein Stück weit die Handarbeit, den menschlichen Beitrag. Dieses aufwendige System der Sichtbarmachung dient letztlich also auch einer Verdunkelung, einer Verdeckung. Ein beabsichtigtes Paradox, das seine Bekräftigung in der Tatsache findet, dass die grossen Fabriken, Fabrikstädte für Aussenstehende, auch für die Ehefrauen der Arbeiter, nie zugänglich waren, dass sie in sich geschlossene, fast autarke Städte waren.
Der Mensch spielte in diesem fotografischen Industrietheater eine geringe, manchmal verschwindend kleine Rolle, oft verschwand er auch ganz. In einem Saal voller Spinnmaschinen waren die Erschütterungen bei voller Leistung so stark, dass ein Foto lediglich am Sonntag, am Ruhetag gemacht werden konnte – ohne die Dynamik, ohne die Menschen des Werktags. Manchmal wurde der Mensch als Grössenvergleich hingestellt, nach der Fertigstellung eines besonderen Werkstücks zum Beispiel, wie beim Foto eines Spiralgehäuses der Escher Wyss für ein Kraftwerk in Asien. Er diente da der blossen Sichtbarmachung des Produkts, diente als Massstab für die Grösse und Grossartigkeit der Maschine. Das änderte sich erst, als freie Fotografen – im Auftrag der Aufklärung, des Widerstandes, und später auch im Auftrag der visuellen Aufrüstung, der Medienquote – die Fabriken betraten. Diese Fotografen änderten die Blickrichtung, sie stürzten sich auf jedes Staubkorn, nahmen es im Streiflicht auf, bis es sich hoch wie die Alpen auftürmte. Sie wurden von Schmutz und Schweiss wie Mücken angezogen. Schlagartig entstand eine ganz andere Sichtbarkeit, eine, die kein Produkt vorträgt, sondern sich dem Arbeitsprozesss, dem Arbeitenden, der Würde, dem Stolz, den körperlichen und psychischen Belastungen der Menschen bei der Arbeit annimmt.
2.
Industriefotografie war also im Grunde genommen immer Produktefotografie. Sie stellte Zahnräder, Pumpen, Triebwerke bestmöglich arrangiert und ausgeleuchtet in den Vordergrund und rückte dafür die Menschen in den Hintergrund. Arbeiter störten das Bild der technischen Fertigung, der maschinellen Perfektion. Entsprechend hatten sie möglichst unsichtbar zu sein, so lange jedenfalls, bis den freien Reportagefotografen der Zugang zur Industrie möglich wurde, bis die geschlossenen Industrieareale, die fast autarken, ummauerten Industriestädte sich teilweise öffneten. Die Reportagefotografen veränderten den Zugang, das Blickfeld der Wahrnehmung. Sie schufen mit ihren handlichen Kameras – Rolleis oder Leicas – eine neue, andere Sichtbarkeit: Der Blick fiel von nun an für Dekaden auf den Menschen bei der Arbeit, auf seinen Einsatz, seine Konzentration, seine Aufopferung. So wie heute die Handyfotografie und ihre Verbreitung im Netz das Monopol der professionellen Pressefotografie durchbricht, so knackte damals (in den dreissiger, vierziger, fünfziger Jahren) die freie, engagierte Fotografie das visuelle Monopol der Fabrikherren.
Kein Blick ist jedoch gegen Abnutzung, gegen seine eigene Kommerzialisierung gefeit. So erscheinen in den sechziger, siebziger, achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts massenweise Bilder von körperlicher Arbeit. Es entwickelte sich mit der Zeit ein visueller Kult der Anstrengung und des Leidens. Stellvertretend für viele andere wird an der Fotografie des Brasilianers Sebastião Salgado deutlich, wie die Konzentration auf das Körperliche, das Strenge, das Schwere, wie dieses überdeutliche Herausarbeiten von Schweiss und Leiden auch wieder zu einer Verstellung des Blickes führen kann. Der visuelle Kult der körperlichen Arbeit konzentriert sich so sehr auf den spannungsgeladenen Körper, den diagonal ins Bild tretenden Arbeiter, das Glänzen erhitzter Haut, das tief verschmierte Gesicht, dass körperliche Anstrengung und (damit verbunden) Armut oft individualisiert, personalisiert und dadurch gleichsam schön geredet, „heiliggesprochen“ werden. Dieses Bild des Arbeitens lief Gefahr, zum Manierismus zu werden, zur foto-akademischen Manier, wie Arbeiter, wie Arbeit zu fotografieren ist. In Zeiten grosser Handelsströme, wachsender globaler Wirtschaftsverflechtungen, im Filter von Strukturalismus und Systemanalyse, die das autonome Subjekt gefährdet und in neuen Rollen sehen, auf dem Weg einer abstrakter werdenden Welt schien diese Fotografie der körperlichen Arbeit das herkömmliche Menschsein selbst „ein letztes Mal“ aufscheinen lassen zu wollen: ein letzter Schrei des menschlichen Ursprungs, des Persönlichen, bevor wir in eine neue Welt eintreten; die nostalgische Hymne einer vergehenden, sich zumindest geografisch verlagernden Arbeitswelt.
Selbstredend gilt, da wir beim Thema der handwerklichen Arbeit sind, dass diese Fotografien handwerklich von bester Qualität waren und sind, dass der Aufbau der Bilder ausbalanciert, die Silberschwärzen tief und zeichnend sind, das Korn perfekt-scharf ist. Jegliche Chemierückstände wurden lange und sorgfältig ausgewaschen. Sie sind in ihrer späten Form (der vergangenen 20 Jahre) auch ein Sinnbild für das Aufbäumen der analogen Fotografie auf dem Weg ins Digitale. Das Aufbäumen der Verankerung gegen das Mobile, der Erdenschwere gegen die Leichtigkeit der Abstraktion, der Abstraktion der AG, des Geldes, der digitalen Welt, der global zirkulierenden Investitionsströme.
Die Medien schliesslich griffen und greifen diese Bilderform besonders gerne auf, denn sie garantierten Identifikation, Sentiment oder Exotik, alle drei bekanntermassen verlässliche Garanten für gute Verkaufszahlen. Sie lassen sich zusätzlich auch perfekt mit dem Mythos der Anstrengung des Fotografen unterfüttern, der sich persönlich einsetzt, aussetzt, der sich an dunkle Ort begibt, der sich verausgabt – das biographische Moment des Fotografen als eine Art Road Movie der Wahrheit. Hier überstrahlt die attraktive Ausstrahlung des persönlichen, individuellen Schaffens und Leidens das schwer Erkennbare, das strukturelle Problem der Arbeit und Arbeitsteilung.
3.
Eine Fotografie, die versucht, der Entkörperlichung der Arbeit und der visuellen Unverständlichkeit ihrer Werkzeuge „Herr“ zu werden, dem Unsichtbarwerden der Arbeitsabläufe, dem Sachlichwerden, Nüchternwerden der Arbeitsumgebung, dem Verlust an äusserer Gestalt, die auf das Funktionieren des Gegenstandes schliessen lässt, suchte man lange vergeblich. Es schien fast, als hätte es der Fotografie die Sprache verschlagen, als gäbe es gar nichts mehr zu sehen, sicher jedoch nichts Wertvolles mehr festzuhalten. Die Fotografie tat sich schwer mit der Verlagerung der Inhalte in ungreifbare, unsichtbare Blackboxes, in stumme, fast gesichtslose Architektur, die weniger wie real Gebautes, denn wie eine Grossleinwand wirkt. Und drinnen Tisch, Stuhl, Schrank, Computer, Drucker – die wenig fotogene Grundausrüstung der Dienstleister.
Der Amerikaner Lewis Baltz, der sich der Landschaft als Territorium, das Territorium als gebauter, gestalteter, besetzter Raum, angenommen hat, ist eine der wenigen frühen Ausnahmen. Er zeigt in den 1970er und 1980er Jahre das Gebaute – zum Beispiel die „Tract Houses“ in ihrer gleichgültigen Banalität, die „New Industrial Parks“ in ihrer unterkühlten, minimalistischen Eleganz – als stumme, fast gesichtslose Architektur. Lewis Baltz musste dann und wann eine Übereck-Aufnahme beifügen, damit wir weiterhin glauben, er habe Gebäude, gebaute Körper und nicht Grossleinwände aufgenommen. Seine Häuser und seine Städte erzählen nichts von den heroischen Skylines, nichts von den Kathedralen der anonymen Gesellschaften, sondern vom endlosen, postindustriellen anonymen amerikanischen "Vorgarten" des Mittelstandes. Retortenhäuser und -städte, die die abendländische Idealstadt mit einem Zentrum und sinnhafter, hierarchisch angeordneter Struktur pragmatisch-wirtschaftlich unterlaufen. Real-Estate-Landschaft, von Baltz wie ein Landvermesser abgeschritten und fotografisch verbucht.
Frank Breuer führt diese Arbeit in den letzten Jahren fort. Einzig die aufmontierten oder aufgemalten Logos der Unternehmen lassen die Schachtelfabriken, Schachtellagerhallen voneinander unterscheiden. Sonst sieht man nichts, kann man die Sache, den Inhalt, die Funktion nicht greifen, nicht begreifen. Arbeitsplätze haben an „Charakter“ verloren, wie man immer sagt, an Patina, an Lesbarkeit, was darin gearbeitet wird. Ein Grossteil von Räumen, in denen gearbeitet wird, gleichen sich aufs Haar, Stil- und Preisunterschiede ausgenommen. Nicht verwunderlich, dass sich die Fotografie schwer damit tut, einen Zugang zu finden, über diese glatte Oberfläche hinaus etwas zeigen, aussagen zu können, das die Bilder unterscheidet vom Geschoss drüber, drunter, vom Haus gegenüber oder nebenan. Die Arbeit von Jacqueline Hassink geht dieses Problem seriell-strukturell an, indem sie zum Beispiel „The Table of Power“ fotografiert und zu Gruppen zusammenstellt, die Zimmer der Machtentscheidungen. Oder indem sie CEO’s zuhause fotografiert, sie also aus ihrem Berufszusammenhang rausnimmt, verschiebt und entfunktionalisiert. Die angeführten Fotografen setzen den Bildpurismus und die Form-Inhalt-Deckung als kritisches Instrument ein, ersetzen die Illusion der fotokünstlerischen Fertigkeit, des attraktiven Motivs durch die serielle mechanistische Beschreibung und zwingen derart dem Betrachter seiner Fotografien, also uns, dem Subjekt der Betrachtung, eine grundsätzlich neue Rolle auf: ohne Wahl und unsentimental den Blick auf die Welt vor ihm, auf die aktuelle, gegenwärtige Welt zu richten.
Als Max Kozloff „Where have all the people gone?“ als Titel über die amerikanische Fotografie der siebziger Jahre setzte, wusste er noch nichts von der Leere heutiger Produktionsstrassen. Der deutsche Fotograf Henrik Spohler visualisiert in seinen Bildern von zeitgenössischen Produktionsstätten das Normierte, Strukturierte, das mechanisch-elektronisch aufeinander Abgestimmte der neuen Fabrikationswelt, die menschenleer und fast klinisch sauber erscheint. Eine Welt, die beim Installieren voller Arbeitender ist, doch „vor dem Anpfiff“ bewegen sich alle, wie 60 Sekunden vor dem Start eines Formel 1-Rennens, von den Autos, vom Produktionsbereich weg. Was zuvor wie ein orientalischer Bazar anzusehen war, wirkt plötzlich menschenleer und technoid. Beim Startschuss der Produktionsstrassen, beim Einschalten der Strom- und Informationsflüsse verschwinden alle Menschen, ihre geleistete Arbeit geht „unsichtbar“ ein in das perfekte, computergesteuerte Funktionieren von technologischen Abläufen.
Die Arbeit verändert sich in der postindustriellen Welt von „body driven“ zu „brain driven“ und im Zuge dessen verschwindet ein grosser Teil ihrer Sichtbarkeit. Der Entrückung der Arbeit folgt jene der Häuser und Hallen, die Containisierung der Transporte von Gütern, die Gestaltung von Gegenständen frei von ihrer eigentlichen Funktion. Und der Mensch? Das blütenweisse Hemd, der perfekte Haarschnitt, das fast pudertrockene Gesicht funktioniert nach dem Prinzip der Sichtbarkeit der Unsichtbarkeit. Dieses Outfit zeitgenössischer Dienstleister ist Zeichen dafür, dass nichts zu Beunruhigung Anlass gibt. Der perfekte moderne Torso soll jede Anstrengung verbergen, unsichtbar machen, soll blütenweisser Schein, soll der brand für unbeflecktes, kontrolliertes Arbeiten sein. Der Primärkörper, der existenzielle, arbeitende Körper, verschwindet aus dem Bild, und dafür taucht der gestählte, trainierte, geformte Freizeit- und graublau gewandete Nüchternheitskörper auf. Geradeso wie normales Brot verschwand und als Bio-Dinkel-Multikornbrot in neuer Handelsgrösse und -form wieder auftaucht.
Das fotografische Bild von Arbeit im 20. Jahrhundert visualisiert, wie sich die Arbeit vom Handwerk zur Roboterstrasse, von der Produktion zur Dienstleistung und von der Berufung zum blossen Job verändert. Dabei wird zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches verschleiert: zuerst die Arbeit selbst, dann jene des Menschen in der Arbeit, später das System, die Struktur der Arbeit, und schliesslich auch die Sichtbarkeit der Arbeit am Menschen. Heute prägen, zeichnen nicht mehr die Arbeitsprozesse den Menschen, sondern umgekehrt: Lifestyle-Zeichen, Labels, Brands überstrahlen die einstige prägend-wichtige Sichtbarkeit „Arbeit“.