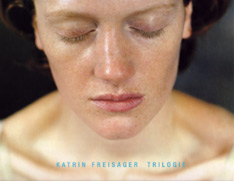‹Identität› bedeutet vollkommene Übereinstimmung, meint Gleichheit, Wesenseinheit in Bezug auf Dinge, Personen, auf sich selbst. Identität ist gleichzeitig etwas, das entweder gesucht, errungen oder dekonstruiert werden muss – ist also eine Konstruktion. Wir können uns mit der Suche nach einer ‹wahren› oder selbst definierten Identität beschäftigen, oder mit der Analyse ‹falscher›, gesellschaftlich verordneter Identitäten. Niemand ist a priori mit sich selbst identisch; vielmehr befinden wir uns mehr oder weniger bewusst in einem laufenden Identitätsdiskurs. Der Identitätsbegriff versteht den Menschen als radikal gesellschaftliches Wesen, im Gegensatz zu anderen Selbst-Verständnissen, die das Selbst durch Introspektion oder in Bezug auf eine metaphysische Grösse definieren würden.
In der bildenden Kunst formte sich seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Ur-Frage «Wer bin ich?» zur zentralen Suche nach und Befragung von Identität. Das Aufbrechen der Norm einer verordneten und die ersten Schritte auf dem Weg zu einer frei gewählten, selbstdefinierten Identität finden wir in den Happenings und Performances dieser Zeit verkörpert. Beispielsweise manifestierte die Performance mit der Einführung der Dimension ‹Zeit› in die bildende Kunst – Vergänglichkeit und Flüchtigkeit des Kunstwerkes, Aufhebung des Objekts als wichtiges Ziel der Kunst – den Protest, die Verweigerung der traditionell männlichen Werte, die mit Begriffen wie Ewigkeit, Unvergänglichkeit, Wahrheit, Geniekult, einzigartiges Werk zu beschreiben sind und im Männlichkeits-Gehabe des damals dominierenden Abstrakten Expressionismus erneut einen Höhepunkt erlebten. Barnett Newmans Bildtitel Vir Heroicus Sublimis kann als exemplarische Veranschaulichung dieses Denkens angeführt werden.
Dieses Zeitelement, vor allem aber auch die starke Betonung des Körpers machten die Performancekunst zu einem bevorzugten Medium feministischer Künstlerinnen der 60er und 70er Jahre – wird doch traditionellerweise der Mann mit Geist, Idee, Abstraktion identifiziert, die Frau hingegen mit Körper, Fortpflanzung, Unreinheit, Intuition. Der Feminismus setzte hier zu einer Umwandlung der Werte an, einer Neubewertung des Körpers und der Sexualität. Im Nachkriegs-Feminismus finden wir ein Grundmodell aller Identitätsdebatten: Die Frau wird unterdrückt durch die Zuschreibung einer vorgeblich natürlichen, tatsächlich aber gesellschaftlich kontrollierten Rolle, mit der sie sich von klein auf zu identifizieren hat. Sie versucht nun, diese Identifikation zu durchbrechen und sich eine neue Identität zu schaffen, verbunden mit einer Neudefinition der Werteskala. Künstlerinnen wie Valie Export, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, aber auch männliche Kollegen wie Urs Lüthi, Jürgen Klauke, Luigi Ontani zeigen in ihren visuellen Erkundungen, dass die Verordnung, Zuordnung von Identitäten ein zentrales gesellschaftliches Machtinstrument ist – während die Erfindung einer eigenen Identität oder das Spielen mit Identitäten zu einer Form des Widerstands wird. Bei diesen Künstlerinnen und Künstlern wandelt sich auch die Funktion der Fotografie: Aus der Dokumentation einer Performance wird eine Foto-Performance, eine Aktion, die ausschliesslich für das Bild, für die Fotografie inszeniert wird. Diese Form der inszenierten Performance wird zu einem zentralen Gestaltungsmittel der 70er, 80er und 90er Jahre.
In den 90er Jahren erhielt diese visuelle Identitätsdebatte neuen Schub. Angesichts der Konzepte und Leistungen von Gentechnologie, Neuro-Science, vernetzter Intelligenz, aber auch von Globalisierung und Neuordnung der Wirtschaft, und damit der Gesellschaft, stellte sich nun die Frage nach dem Stellenwert des Individuums (nicht mehr so dringlich akzentuiert hinsichtlich des Geschlechts) in diesen neuen vernetzten künstlichen Systemen. Die herkömmlichen Vorstellungen von geschlossenen, nach innen gerichteten Wesenheiten – Entitäten – scheinen sich dabei aufzulösen; die einst verlässlichen, ‹gründenden› und begründenden Einzahl-Heroen – das Ich, das Du, die Identität, die Wahrheit, das Recht, die Wirklichkeit oder auch die Nation – scheinen sich zu multiplizieren, sich in der Vernetzung zu dynamisieren. «Wer bin ich?» verschärft sich zur Frage: «Wer ist ‹Ich›?», was ist es denn, das Ich. Ich bin viele, heute die, morgen der. Jedenfalls bin ich ein verknotetes Subjekt, vernetzt, weit entfernt von der einst postulierten Autonomie.
In diesen Kontext fügt sich Katrin Freisager mit ihren Arbeiten. Zum Beispiel mit ihren frühen Matratzen-Bildern (‹Ohne Titel›, eine offene Serie seit Beginn der 90er Jahre): Jüngere Frauen liegen auf unbedeckten Matratzen. Sie liegen in Unterwäsche da und sind von oben herab fotografiert. Anschliessend werden die hochformatigen ‹Porträts› als Grossvergrösserungen an die Wand gehängt, leicht über Augenhöhe, so dass die Frauen auf die Betrachter herunterschauen. Das Setting dieser ‹falschen› Porträts – falsch, weil nicht das abgebildete Individuum gemeint ist, trotz Nennung des Vornamens, sondern die Figur – wirken wie Kleinbühnen, voller angelegter Widersprüche. Die wenig bekleideten Frauen verführen, aber ihre Verführungskraft wirkt seltsam neutral, aufgehoben. Die Figuren erscheinen fragil, entblösst durch den Blick der Fotografin von oben, doch gleichzeitig kippen sie dem Betrachter entgegen, liegen stehend, stehen liegend, und verharren so in einem rätselhaften Schwebezustand: weder Subjekt noch Objekt, weder aktiv noch passiv, und doch alles zugleich. Der Blick des Betrachters verfängt sich in beigefarbigem Nylon und weiss nicht mehr, wieso er sich verführt gefühlt hat. Es sind Situationen, die den Anker heben, Konstellationen zwischen Betrachter und Betrachteter werden initiiert, die angestammtes Gefälle aufheben. Wer steht fragiler da, diese Frauenfiguren oder ich als Betrachter? Gleichzeitig demonstrieren die Werke ein erstes Mal, wie sorgfältig Katrin Freisager ihre kleinen Bühnenstücke inszeniert, wie die Farben, die Materialien aufeinander abgestimmt sind, wie eine seltsame Balance sich einstellt.
In ‹Color of Skin› (1999) fällt als erstes die doppelte Raumerweiterung auf. Die Frauenfigur erhebt sich, steht im Raum, bewegt sich darin, ‹fällt› in einem Bild fast aus dem Bildgeviert in den Betrachterbereich, und gleichzeitig erweitert sich ihr Körper, wird Raum, wird Teil des Raums, changiert von Mobilie zu Immobilie, stösst sich davon ab und versinkt in ihm, gleicht sich ihm wie eine Textilie an. Umgekehrt wechselt der Raum seine Funktion, wird aktiv, wird Akteur, ist nicht nur stilles Environment, sondern ‹sprechender› Darsteller. Eine Raum-Personen-Gleichwertigkeit stellt sich ein, die leicht surreal anmutet, weil alles zu fliessen oder alles sich zu verfestigen scheint, weil Raumhülle und Körperhülle in einander verwoben werden. Das Surreale manifestiert sich in der Angleichung von organischer und anorganischer Natur, im Gleichgewicht zwischen Innenhülle und Aussenhülle, von Bühne und Akteur. Der Raum ist ebenso Akteur wie die Frau, die Frauenfigur ist ebenso raumstiftend wie der Umraum. Die Blickwinkel in den Raum und auf die Frau und die Rhythmisierung der Bildabfolge dynamisieren die Szenerie, lassen sie filmisch erscheinen. A touch of horror: einen Anflug des Schreckens wird der Betrachter nicht los. Jedenfalls beruhigt die Vorahnung, dass der Radiator im nächsten Moment loszumarschieren scheint, nicht wirklich. Hier wird die Aufhebung der klassischen Subjekt-Objekt-Differenzierung eingeläutet, Verlebendigung des Umfelds als neuer Faktor im Identitätsdiskurs.
Mit dem grossen, siebenteiligen Fries ‹Living Dolls› (2000) verschreibt sich Katrin Freisager deutlich dem Hybriden, dem Spiel mit der Grenze zum Künstlichen: Die Arbeit zeigt schöne, makellose Modelle, die auf einer sterilen, hellen, genoppten Unterlage aus Schaumstoff gleichsam schweben, entschweben. Es scheint, als ob Katrin Freisager hier ihre Matratzenbilder in neuer Form inszeniert. Die spärlichen, halb durchsichtigen, hautfarbenen Kleider spielen mit dem Nacktsein, dem Körperlichen, Sexuellen, aber sie neutralisieren es auch zum Teil. Die Struktur der Abfolge – bis auf eine Figur tauchen alle in zwei Perspektiven und zwei unterschiedlichen Konstellationen auf – löst das Einmalige, das Persönliche auf, ohne Drama, ohne Sentiment. Wir meinen neuartige Medienwesen, biologisch angereicherte Cyborgs vor uns zu haben, mit einem schwarzen Wesen in ihrer Mitte, das gleichermassen fremd erscheint, wie es dem Reigen menschlicher Künstlichkeit optischen Halt verleiht. Die Haut der ‹Living Dolls› ist so gereinigt, geglättet, die Körper sind so idealisiert, der Sinnlichkeit entzogen, dass Mischwesen der Kategorie ‹Triple A› entstehen, die mit Eleganz und ohne besondere (störende) Eigenschaften in allen Bereichen der totalen Dienstleistungsgesellschaft einsetzbar sind.
Drei rätselhafte junge Frauen versammeln sich – quasi schwebend, auch abwesend wirkend – zu einer Gruppe der Ähnlichen in ‹To be Like You” (2000). In einem Raum, der deutlich abstrakter ist als in ‹Color of Skin› – ein dunkelbrauner Bühnenraum, gebildet aus Parkett-Boden und dunkelbraun gebeizter Rückwand, mit einer Öffnung rechts im Bild, die das Absolute des kargen Bildraums bricht und das Bühnenhafte unterstreicht. Darin spielen sich Situationen ab, deren Anfang und Ende wir nicht kennen. Helle, fast blasse Frauenfiguren in hautfarbenen Strumpfhosen und heller Unterwäsche finden sich zu Konstellationen. Halbnackt, in einzelnen Situationen fast androgyn wirkend, gruppieren, verkeilen sie sich, oder spalten, splittern sich auf. Wie fremde Puppen, wie ‹Rivalinnen› oder ‹Mann und Frau› andeutend, situieren sie sich auf dieser Plattform. Ihre Ähnlichkeiten überdecken die Differenzen; die Figuren wirken eigenschaftslos gleich. Haut evoziert Nähe, die nicht eingelöst wird. Der Blick prallt an den attraktiven Oberflächen auf und wird zurückgeworfen. Alles, was wir sehen, wirkt rätselhaft, selbst die Nahblicke auf Füsse, auf Hände, auf ein Gesicht. Das Unentschiedene der nach Ähnlichkeit strebenden Wesen irritiert und fasziniert. Eine Erzählung, die verschwimmt, unsichtbar ist, und sich nur in Bruchstücken, in Fragmenten andeutet. Wir als Betrachter stehen draussen, sind nicht einbezogen, kein Blick fällt auf uns.
Das Charakteristische, das Bedeutungshafte wird in ‹Untitled› (2002) noch weiter zurückgedrängt. Der Titel ‹Ohne Titel› ist Programm. Die Arbeit erscheint als konsequente Fortsetzung einer zunehmenden Abstraktion: Der Raum ist noch reduzierter, löst sich in einem hellen Blau auf, das weder Grund noch Hintergrund definiert, vielmehr wie ein endloser transparenter Raum erscheint. Vor und in dieser Undefiniertheit formieren sich Glieder von Figuren. Helle Beine, Arme, Hüften, Hände, Gesichtsteile, vermischt mit Haaren, roten, braunen, dunkelblonden. Diese Glieder verschränken und verwickeln sich. Und unser Blick fällt eng geführt auf die Knotenpunkte, die ‹Verkehrsknotenpunkte› dieser Gliederknäuel, ohne dass wir wissen, woher die Achsen kommen oder wohin sie führen. Diese Frauenfiguren sind zu Gliederpuppen reduziert, glatt, attraktiv, pastellfarbig, sie erscheinen so gereinigt und wiederum merkmalslos wie eine Werbekampagne für Strumpfhosen. Besondere Merkmale gibt es keine mehr, besondere Berührungen der Glieder ebenso wenig. Katrin Freisager arbeitet jetzt wie eine Malerin, die Körperteile werden für die Bildfläche arrangiert, in Beziehungen gesetzt, die ohne grosse Spannungen aggressionslose Gelassenheit ausstrahlen. Diese übernatürlich perfekten Bilder wirken emotionell distanzierter, sie lesen sich als die reine visuelle Verführung der Farben, Formen, der Andeutungen ohne Zugabe – und gleichwohl ziehen sie uns mittenrein, stehen wir quasi darinnen, deuten sie gerade soviel an, dass unsere Sinne und unsere Lesefähigkeit angeregt werden. Die Bilder sind unaufgeregt formuliert, wie die visuelle Entsprechung zu Designer-Drogen.
Der Blick auf die fünf hier angesprochenen Werkgruppen konzentriert sich auf ein mehrfaches ‹Dazwischen›: Rollen werden angespielt und aufgelöst, Räume aus ihrer Immobilität gelockt und dynamisiert, der Betrachter wird verführt und irregeführt, und auf sich selbst zurückgeworfen, er sieht sich ‹chemischen› Vorgängen gegenüber und weiss nicht, weshalb ihn das verführt. Diese Kleinszenen deuten Vorgänge, Erzählungen nur an und heben sie gleich wieder auf, entrücken sie der Zeit und lassen sie bewusst zwischen Realnahem und Fiktionalem schweben. Es sind fragile Konstellationen, die das Zarte im Klinische abkühlen gleiten lassen, das Menschliche in Technologisches, in Cyborgiges verwandeln, Festgefügtes in die Attraktion von Fragmenten auflösen. Das Eigenschaftslose der Figuren gibt ihnen die Qualität, perfekte Projektionsflächen zu sein: Wir Betrachter beleben diese Puppen, wir hauchen ihnen mit unseren Fantasien Leben ein.
Die Übergänge von natürlich zu künstlich, real zu virtuell, analog zu digital, von homogenen zu heterotopen Räumen, die wir draussen in der Welt festmachen können, haben das Hybride zum zentralen Faktor unserer Zivilisation werden lassen. Heutige Kultur ist hybrid. Die Membranen unseres Körpers und Denkens sind so stark von den Elementen einer vernetzten künstlichen intelligenten Umwelt durchdrungen, dass sich unsere angestammte Subjekt-Objekt-Vorstellung, unsere Identität auflöst, aufsplittert, dass sie ins All geschleudert wird, und dort schweben ihre verführerisch-neutralen Teilchen frei im Vakuum. ‹Space-Artist› Katrin Freisager ist auf dem Weg zu ihnen, um in ihren Fotoserien diese neuartige Umstandslosigkeit zu visualisieren.