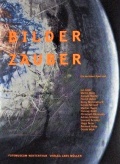Wie ernst doch das Bild im 20. Jahrhundert genommen wurde. Gerade so, als sei es der wahre Prospekt der Welt, als sei es Gesetzestafel, Exerzierfeld oder Schablone, über man die Welt zu dirigieren vermöge. Gerade so, als entspräche der weissen Leinwand die hohe, reine, absolute Zeit, der schwarzen die leere Zeit, das Nichts, der roten die aktive, blutige Zeit – abstrakte Leinwände, doch höchst bedeutungsgeladen. Inbrünstig ernst, innig-poetisch ernst bisweilen, gedanklich ernst auch und dampfend-erhaben ernst waren Bilder und Haltungen, selbst die grössten Ketzer schienen dagegen nicht gefeit. Wie die Prägungen von Marinetti – «Der Futurismus beruht auf einer vollständigen Erneuerung der menschlichen Sensibilität»1 –, von Malewitsch – «Im weiten Raum kosmischer Feiern errichte ich die weisse Welt der suprematistischen Gegenstandslosigkeit als Manifestation des befreiten Nichts»2 –, von Max Bill – «Die konkrete Kunst (...) soll der Ausdruck des menschlichen Geistes sein, für den menschlichen Geist bestimmt, und sie sei von jener Schärfe und Eindeutigkeit, von jener Vollkommenheit, wie dies von Werken des menschlichen Geistes erwartet werden kann.»3 –, von Richard Paul Lohse – «Serielle und modulare Gestaltungsmethoden sind durch ihren dialektischen Charakter Parallelen zum Ausdruck und zur Aktivität in einer neuen Gesellschaft»4 – und schliesslich vom lakonisch-absoluten Barnett Newman – «The Sublime is now» –, wie diese und viele andere Manifeste, so präsentierten sich auch die Bilder, und so wurden sie auch «vernommen». Beinahe wieder gnostisches Schwadronieren. Dieser heilige Ernst, der Avantgarde auf Avantgarde prallen liess, diese Radikalumkehr der Urbotschaft «Du sollst dir kein (Gottes-) Bild machen»5 würde nicht weiter erstaunen, hätten nicht der utopische Anspruch (nach diesem Bild wird die Welt eine andere sein) und die Geschehnisse in der Welt (kann man nach dieser Welt, nach Auschwitz, noch dichten?) so grundlegend auseinander gelegen. So aber erregt dieser Ernst einen doppelten Verdacht. Wurden die Bilder vielleicht zum wichtigen militärischen Nebenschauplatz und zur notwendigen psychischen Fixierung angesichts des Fanals der Geschichte, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts politisch nicht schrecklicher und wirtschaftlich nicht heftiger sein, also nicht hilfloser machen konnte? Das Bild: nicht nur als es selbst so ernstgenommen, auch nicht lediglich als Metapher, sondern in der Funktion als Refugium und als Surrogat der Welt, und dennoch vorgetragen mit dem vollen Ernst von «Wirklichkeit», der ganzen Kraft utopischer Projektion und im Rhythmus der gesellschaftlichen Zeit? Das Bild demnach als eine Art von Realitäts-Stellvertreter?
Januar 1996
Seriöses Spiel
Die Kunst lernt das Lachen wieder
«Bilderzauber – ein seriöses Spiel» präsentiert einen anderen Werk- (und Lebens-) Bereich, eine Ergänzung, ein Auflösen, Ausfliessen, manchmal eine Gegenwelt. Darin ist die Rede von Bergen, die keine sind, von Unfällen mit Würsten und brennendem Pappmaché, von geteilten Frauenleibern, von verlorener Natur und ebensolcher Wahrheit, von Fotografie, die Zeichnung, von Zeichnung, die Fotografie ist, vom Schein, der trügt, und vom reinen Scheinen, von der falschen und der einfachen Feier. Gäbe es Manifeste, so sagten sie: Der Schein trügt, und das macht auch Spass; der Stil ist am Ende, Gott sei dank; die Welt mutiert, schauen wir hin. Ja, es ist ein Spiel – «Im Ausklang der Moderne lernte die Kunst das Lachen wieder»6 –, aber ein seriöses. Ja, es geht um den Bilderzauber, aber ebenso um den falschen Zauber, das Vorgaukeln, das Flunkern. Hautnah und doch nicht eigen. Merkwürdige Kühe, falsche Schweine – und der Hase, er kommt gleich doppelt, gespiegelt, aus dem vollen Buch, nicht aus dem leeren Hut. Und die Aura, das Erhabene der lichtdurchfluteten Kuppel? Sie geht auf über einem Salatsieb aus Plastik, fotografiert mit Polaroid, ebenfalls aus Plastik, vor Neonlicht. Das Bild und die Dominanz der Form stehen hier öfters auf dem Spiel, mit ihnen unsere Wahrnehmung, unser Ernst, unsere Suche nach dem geraden, eingefassten Weg, unsere Sucht nach dem formalisierten Werk.
Wer kann sich das denn 'leisten' – diese Distanznahme, dieses Unterlaufen formaler und inhaltlicher Werte, von feiner Ironie bis zum hämischen Gelächter? Hochkonjunkturkunst? Vielleicht. Zeitlich - 1955 bis 1995 - kommt das fast hin, doch wird man geboren in eine Zeit; inhaltlich manchmal auch, wird doch die Wurst übers Filet, der Karton über Eisen, Stein und Marmor wieder aktuell, wirkt doch das Ende existentieller Not befreiend auf die Voraussetzungen des Denkens. Tam tam, dekonstruiert von Anfang an. Jedenfalls wurden in diesem Zeitraum, mit schwerpunkt, in den siebziger Jahren, Wahrnehmung und Bild einer breitangelegten andauernden ernsthaften Prüfung unterzogen. Einerseits wurde das Sehen und Erkennen befragt und analysiert, andererseits wurde der Glaube an und die Realität des Bildes in Frage gestellt: auf der Fotoebene in Form der Absage an das Einzelbild, hin zu Reihen, Serien, Sequenzen; in der Malerei als Sprengung des Gevierts, der Begrenzung, als Auslaufen des Bildes an der Wand, in den Raum, ins Leben hinein. In beiden Fällen geht es um Entmystifizierung, um Entschlacken von Bedeutung, von Gefühlsschwere. Von nun an reichen Träger – Chassis, Leinwand oder Fotopapier – und eine Oberfläche – Grundierung, Farbauftrag oder Fotoemulsion – sowie ein paar Gedanken, Versuche, Aspekte. «Support/Surface», wie eine französische Gruppierung sich lakonisch nannte. «Visuelle Denkprozesse», wie die Aargauer und Luzerner Kunst damals genannt wurde, subjektivierende Notate, von Harald Szeemann als zeitgenössische individuelle Mythologien begriffen, so lauteten einige der kategorisierenden Begriffe.
Vorläufer
Bevor wir jedoch mitten hinein steigen, vergessen wir nicht, dass dies alles schon in den geliebt-geschmähten Nierentisch-Fünfzigerjahren vereinzelt angefangen hat. Als ein junger «Schnösel» die Doktrin bildnerischen Gestaltens wortwörtlich an den Strom hängte. Jean Tinguely, ein Elektromotor und Batterien setzten die damalige Staatskunst in Bewegung. «Meta-Malévich» war geboren, eine Serie von 18 schwarzen Holzkästen, mit je unterschiedlich vielen weissen Metallelementen – Dreiecken, Kreisflächen, zeigerähnlichen Rechtecken, Gummiriemen, Metallbefestigungen, Elektromotoren, mal 110, mal 220 Volt, 41 x 41 cm oder 50 x 50 cm Grösse und 10 bis 11 bis 12 cm Tiefe. Später kamen polychrome kinetische Reliefs dazu. Während gleichzeitig der Tachismus, das Informel in der Ablehnung der herrschenden Norm sich in die Reihe der vergangenen und zukünftigen Verabsolutierungen stellte - Verabsolutierung der Komposition durch den Konstruktivismus, der Farbe durch die Monochromie, der expressiven Geste und Energie eben durch Tachismus und Informel -, gab Tinguely diesem Absolutheitsanspruch einen Drall: ironisches Unterlaufen einer Schule und humorvolles Spielen mit sich selbst. Die Gestaltungsdoktrin brach dadurch nicht, jedenfalls noch lange nicht zusammen, hatte sie doch gerade erst als «Gute Form» die gesellschaftliche, heisst, nun auch bürgerliche Sanktionierung erhalten, aber es war ein erster Ausweg aus den Absolutheitsansprüchen angebahnt. André Thomkins und seine (surrealen) Transformationen, sein Rapport, sein Webmuster als Auflösung jeglicher Zentren, Dieter Roth, der Sprachspieler auf jedem medialen Parkett, und seine Verkehrungen, Verflüssigungen in Zeit und Abfolge sowie Daniel Spoerri und seine Fallenbilder, «Tableaux pièges», waren in den fünfziger und sechziger Jahren weitere herausragende Einzelfiguren einer Art von Neo-Dadaismus.
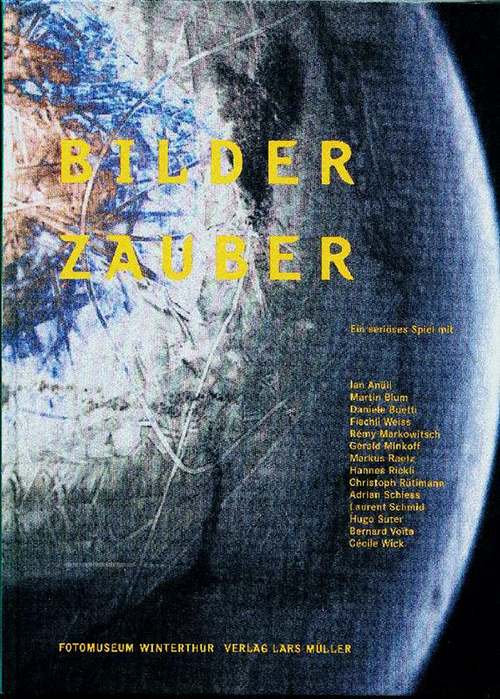
Sechziger und siebziger Jahre
Und dann flatterten 1964 Peter Knapps 36 fotografierte Schweizer Fahnen an der Expo 64, bestätigte Ben Vautier der Leinwand mit seiner Handschrift, dass sie eine «Toile» ist, blendeten 1967 Samuel Buris giftig gemalte und aufgerasterte Chalets die Augen, spielte 1967-69 Jean-Frédéric Schnyders Record-Cover-Art ein Augen- und Fetischspiel, thematisierten 1969/70 Burkhard/Raetz gemeinsam in 15 grossen Fotoleinwänden die Wiedergabe als Objekt – Schwarzweissabbildungen von banalen, alltäglichen Dingen und von Orten, Atelier, Küche, Doppelbett, Vorhang, einem Blatt Papier, wurden auf Leinwänden (gross)vergrössert und an zwei Klammern an der Wand befestigt –, visualisierte Camesi 1969 den «point de conditionnement» und 1971 die «Dimension unique» (das gleiche Porträt mit jeweils anderen Farben umrahmt), schuf Herbert Distel mit seinem Werk «220 V» von 1971 einen leeren Goldrahmen, der sich selbst beleuchtet, und beschäftigte sich Heinz Brand schliesslich von 1965 bis in die achtziger Jahre hinein mit der Relativität des Sehens, mit der Idee, der materiellen Wirklichkeit und ihrer beiden Repräsentation. Aldo Walkers und Rolf Winnewissers je eigenes und bisweilen gemeinsames «Stromern im Bild»7 und Christian Rotachers Klein-Installation von 1978 – eine zirkusähnliche Szene mit einer aufgespannten Leinwand in der Mitte, zwei Hochsitzen je gegenüber und dem Titel: «Fontana, der Tiger, der als erster durch die Leinwand gesprungen ist, uns bleiben die Feuerringe», eine Ironisierung von Lucio Fontanas Akt des Durchschneidens der Leinwand, der Tat – beenden das querschnittartige Ausbreiten.
Diese spätsechziger und siebziger Jahre waren zusammenfassend also eine Zeit der Abkehr: von den abstrakten, reinen, nach Objektivität strebenden Gestaltungsweisen und ihrem gedanklichen Überbau, vom Werk als geschlossener, absoluter Entität; von der Vorgabe des kunstwürdigen Materials und vom Stildenken. Absage auch an die grosse Form, die grosse Erzählung, die übergreifende Wahrheit, das Absolute, dafür Einsicht in die Bedingungen des eigenen Tuns, die Beschränkung der Aussage: «... Setzungen werden nicht mehr als überindividuelle Wahrheit akzeptiert, sondern werden auf ihr Funktionieren, auf ihre Rechtmässigkeit überprüft. Dieser Individual-Anarchismus entspricht einer 'Dekolonialisierung' des Individuums von den Aussensetzungen, von der Aussengesteuertheit, von Konventionen und Übereinkünften.»8 Und es war eine Zeit der unablässigen Erkundung: Reflexion und Relativierung der Welt, der Wahrnehmung, der Kunst, der Bildvorstellungen und -gestaltungen.
Die Werke – vornehmlich die kleine Zeichnung, das sich bescheidende Aquarell, das kuriose, merkwürdige Kleinobjekt sowie das Notizbüchlein – waren in erster Linie Feld, Mittel und Notate von Erkundungen.9 Zunehmend wurde dazu auch die Fotografie eingesetzt, ebenfalls als Mittel zur Notiz, zur Dokumentation, zur Konstruktion und In-Szene-Setzung, aber auch zum Spiel mit sich selbst, mit sich als dem perspektivischen Paradepferd. Für einmal waren sich die Fragen der Fotowelt und der Kunstwelt sehr nahe. Christian Vogts Zeit-Raum-Sequenzen, sein forschendes Spiel mit dem Bildrahmen und Vladimir Spaceks Licht-Raum-Forschung sind gute Beispiele dafür.
Hugo Suter, Markus Raetz, Fischli Weiss, Gérald Minkoff
Stellvertretend für die siebziger Jahre, und natürlich stellvertretend für sich selbst – das Recht gebührt nun der Besonderheit der einzelnen Arbeiten –, sind in der Ausstellung «Bilderzauber» Werke von Hugo Suter, Markus Raetz, Fischli Weiss und Gérald Minkoff vertreten. Suters Werke stehen für die unablässige Wahrnehmungsforschung, Markus Raetz' Werke für sein Wahrnehmungs- und Bilderspiel, Peter Fischli und David Weiss für das Einführen der frech-frisch-freudigen Bilderzählung mit ärmlichen Mitteln und Gérald Minkoffs Werke für die Aneignung der Geschichte über vorhandenes Bildmaterial, mit zugleich modernen und archaischen Mitteln. «Oberflächentaucher» heissen zwei der hier im Katalog abgebildeten Werke von Hugo Suter. Ein Widerspruch, ein Paradox ist damit benannt. Reflexionen eines Fensters auf einem hellen, welligen Stück Plastikfolie sind fotografisch festgehalten. Die Zeichen ähneln Figuren, lassen an Passanten, an Tanzende denken. Eine Täuschung, denn der Eindruck von Fliessendem stammt wohl vom verzerrenden Fensterglas; jede Veränderung des Kamerastandortes erzeugt eine andere Spiegelung. In dieser Täuschung hebt sich der Widerspruch auf. Man braucht kein 'Tiefsinn' mehr zu sein, es reicht, in die Vielfalt des Scheinens auf der Oberfläche einzutauchen. Einige Jahre später fragte sich Suter, den wir uns als einen fröhlich-grüblerischen Denker vorstellen dürfen und der (fast) jeden Tag ans Ufer des (Hallwiler-)Sees geht, was wohl passiere, wenn er die Schärfe weder auf den Grund noch auf die Oberfläche des Wassers, sondern auf einen Punkt ungefähr in der Mitte der beiden Extreme einstelle. Taucht eine neue Welt auf, eine neuer Gedanke? «Schwemmholz zwischen Idee und Repräsentation»10 oder bloss weiterhin trübes, unbestimmtes Gewässer? Einfache Fragen führen zu «visuellen Denkspielen»11, die dann sorgfältig und entspannt durchdacht und materialisiert werden, in Fotografien, aber häufiger in rasterbeschichtetem Holz oder in halbtransparentem, gestrahltem oder geritztem Glas. Das kleine, vielteilig passepartourierte und gerahmte Bild, aber auch die Fotoleinwand mit den zehn seriellen Papiervergrösserungen wirken aus heutiger Sicht wie typische Stilelemente der siebziger Jahre: nämlich das genaue Erforschen und ebenso genaue Aufzeichnen des Vorgehens.
Markus Raetz' Polaroids sind gleichermassen Vorstudien und Notizen zu grösseren Werken wie bisweilen eigenständige Kleinwerke, auch wenn Raetz selbst sie nicht als solche betrachtet. Doch der Schneeberg in Amsterdam, das Salatsieb als kassettierte, lichtdurchstrahlte Kuppel und als eine Hommage an Schinkel, die kleine Lehmfigur und die fotografierte Lehmfigur, die sich gegenseitig mit den Handflächen abstützen, 'am Leben erhalten', die dreifache Betrachtung eines Bildes bei prismatisch aufgefächertem Licht und die Veränderung der Plastizität je nach Streiflicht oder Durchleuchtung – sie sind allesamt Zauberstückchen, die im Kleinen enthalten, was Raetz' ganze Arbeit durchdringt: das Drehen um die eigene Achse bei gleichzeitiger Drehung um eine äussere zweite, dritte, weitere Achse – Planetensystemen gleich, die ständig gegenseitig den Standpunkt verschieben und sich doch gegenseitig bedingen. Zwischen Beobachtung und Konstruktion entfacht er ein forschendes Spiel, das über visuelle Phänomene, über Fläche und Raum, über Verschiebungen vom Wörtlichen zum Metaphorischen, vom Realen zum Fotografierten, vom ersten zum zweiten und dritten Standpunkt, das Relative als Prinzip und als geistige und gestalterische Nahrung ausweist. Da scheint manches anders zu scheinen, als zu sein es scheint – und ein kleines 77 x 79 mm grosses Polaroid lang stimmt es eindeutig: Der schönste Schneeberg steht in Amsterdam, zumal über ihm der kräftigste blaue Himmel hängt.
Sie sind als «Wurstserie» bekannt geworden, diese zehn unscheinbaren, 24 x 30 cm kleinen Farbfotografien – C-Prints, deshalb verlieren sich gegenwärtig die Farben zugunsten von Braunrot –, die Peter Fischli und David Weiss, damals frisch erst ein «Künstlerpaar», 1979 vorgelegt haben. So bescheiden die Serie anmutet, sie enthält all den Sprengstoff ketzerischen Tuns, den Fischli Weiss' spätere Arbeiten, angefangen mit den Weltszenen in Ton, «Plötzlich diese Übersicht», weiter mit den Karotten- und Küchenraffel-«Tänzen» in der fotografischen Reihe «Stiller Nachmittag» bis hin zur farbechten Agglomerations-Idylle von 1992 auszeichneten. «Bei den Höhlenbewohnern» heisst ein kleines Feuerchen im Backofen, «Untergang der Titanic» ein Stück Styropor im Wasser, «Eitles Pack» oder «Modedefilée» die herausgeputzten Cervelatwürste, «In den Bergen» eine schneebedeckte Hügellandschaft aus Bettzeug mit eingelassenem 'Bergseeli'; «Der Unfall», «Der Brand zu Uster», «Pavesi» oder «In Anos Teppichladen» sind die Titel der auf Seite 54-57 abgebildeten Arbeiten. Das Ketzerische formt ein Viereck, einmal ist da das Erzählerische, sonst verpönt im 20. Jahrhundert, dann das fast kindlich anmutende Basteln auf Elterns braunem Mohair-Teppichboden, schliesslich die banalen Materialien – Eierkartons, Würste – bei «anspruchsvollen» Themen wie «Der Unfall» oder «Der Brand zu Uster». Der Ernst der Forschung in den siebziger Jahren schlägt hier um in die schiere Freude am Spiel, am schranken- und doktrinlosen Tun und Lassen. Übrigens führt von Jean Tinguelys «Meta-Malévich» ein sehr direkter Draht zu Fischli Weiss' «Son et Lumière», dieser rotierenden Kleinskulptur mit schnarchendem Geräusch und ewigdrehendem, geripptem Automatenkaffee-Plastikbecher. Dieser kleine, geräuschvolle Wicht unterlief die gesamte grossangelegte, gestenreiche «Metropolis«-Ausstellung in Berlin 1991 mit einem Fingerschnappen.
Gérald Minkoffs «Instantfotochemogramme ohne Kamera» sind etwas zu selten zur Kenntnis genommen worden, vielleicht wirkten sie 1977 noch zu abstrus, um in all ihrenImplikationen wahrgenommen zu werden. Kodak hatte 1977 mit dem Kodak Instant Pr 10 ein Konkurrenzprodukt zu Polaroid SX-70 lanciert und sechs Jahre später den Kampf aufgegeben. In dieser Zeit hat Minkoff eine merkwürdige Serie realisiert. Mittels Lasagne-Walze hat er die Chemie im Foto verteilt, ohne es vorher zu belichten. Während dem Entwicklungsvorgang, der zuerst Schwarz, fünf Sekunde später Blau, 15 Sekunden später Blau-Grün, 20 Sekunden später Rot und 25 Sekunden später Gelb und schliesslich Braun zum Vorschein brachte, zeichnete er von hinten in dieses Instantfoto hinein. Die Linien erhielten gemäss dem obigen Zeitablauf unterschiedliche Farben. Hineingezeichnet hat er «D'après» (Nach); wie die Zeichnung früher nach der Natur, wie die Fotografie wesentlich nach der Natur entstanden ist, hat Minkoff nach der Fotogeschichte ins Foto gezeichnet – nach dem Akt von Thomas Eakins, nach den schwingenden Golfschlägern von Harald E. Edgerton, nach den Äquivalenten von Stieglitz usw. Und dabei zugleich einen eminent zeichnerischen und eminent fotografischen Prozess sowie einen zentralen Aneignungsvorgang ausgelöst: Aneignung der Fotogeschichte in Beispielen, Zeichnen des Bildes durch die Chemieschicht hindurch, dadurch gespiegeltes Endresultat: ein semiotisch brillanter Akt – das Anagramm von Image sei doch Magie – und eine Arbeit, die in Anlehnung an den englischen Pionier Henry Fox Talbot mit «The Pencil of History», 1977-83, betitelt werden könnte.
Achtziger und neunziger Jahre
Natürlich ist die fotografische Sache auch ausserhalb der Schweiz in Bewegung geraten: Sigmar Polkes alchimistischer Einsatz der Fotochemie, William Wegmans Bildsequenzen und -rätsel bereits Anfang der siebziger Jahre, Jan Dibbets Auffächerung der Realität analog zur Form des Auges, John Stezakers bildsemiotische Forschungen sind nur wenige Foto-Beispiele einer internationalen Bewegung der Bilderforschung. Anfang der achtziger Jahre wurde das Bildthematisieren zeitweilig zugunsten energetischer, expressiver Gesten in den Hintergrund gerückt, und erst gegen Ende des Jahrzehnts, unter neuen Vorzeichen, wieder aufgenommen.
Im schweizerischen Kontext entwickelten sich die Thema- und Haltungs-Felder folgendermassen weiter: die Linie der Forschung führen im Bereich Malerei Rémy Zaugg, Aldo Walker und Rolf Winnewisser weiter, im Bereich Fotografie und «Apparatebau, Wahrnehmungsdiskussion» Caludio Moser, Hans Knuchel, Reto Rigassi und Andreas Hofer; eine Mischung aus Forschung und Spiel finden wir bei Hannes Rickli, Laurent Schmid und beim Explosions-Bildhauer Roman Signer aufs Beste realisiert, ebenfalls bei Olivier Richons allegorischem, emblematischem Bühnenspiel, inhaltlich entfernter bei Daniele Buettis Aussen- und Innenhaut-Fotofeldern und bei Ian Anülls Stil-Bild- und Hakenkreuz-Arbeit; die erzählerische Spur wird von Christoph Rütimanns szenischen Polaroids aufgenommen, von Esther van der Bie, Pipilotti Rist und Istvan Balogh; die Triade Forschung-Spiel-Konstruktion findet sich bei Bernard Voïta und Martin Blum; die Aneigungsstrategie führt zu Christian Marclays Record-Cover-Assemblagen, zu «Nach der Natur» von Rémy Markowitsch und zu Sylvie Fleurys Magazin-Cover-Art; die Mischung aus Forschung und Feier – zur Erinnerung: immer des Bildes – finden wir bei Ursula Mumenthaler, Béatrice Helg und Mitja Tušek; schliesslich manifestiert sich Bildfeierisches bei Balthasar Burkhard, Cécile Wick, Adrian Schiess, Andreas Züst und Michael Biberstein (bei ihm vor allem in der Malerei).
Allgemein fällt auf, dass Frauen in der Bildforschung in grosser Minderheit sind; sie haben sich in den achtziger Jahren viel stärker im Bereich der Körper-Fotografie, der performanceartigen Fotografie ihr Ausdrucksfeld geschaffen. Die reine Forschung, wie sie in den siebziger Jahren manchmal selbst wieder mit verabsolutierendem und pädagogisch-didaktischem Ernst gehandhabt worden ist, gibt es kaum mehr; in einer Art post-konzeptuellen Zugangs zur Welt und zur eigenen Arbeit wird das Augenzwinkern zum freundlich-coolen mimischen Standard, der Selbstklärungsprozess verliert das Schmerzlich, er beginnt Spass zum machen. Das Bild schliesslich kann nach all den Analysen, Demontagen, Dekonstruktivismen wieder (unter neuen Vorzeichen) als Bild genommen und gefeiert werden: Forschung-Spiel-Feier als neue zeitgemässe Bild-Megamischung.
Forschung und Spiel
Hannes Rickli beschreibt seine Rauminstallation selbst: «Im abgedunkelten Raum dreht sich eine Kunststoffkugel, gelagert in einem Holzgestell auf zwei rechtwinklig zueinander stehenden Elektro-Antriebsrädern und einer Stützkugel, langsam um eine stabile Achse. Gesteuert werden die Motorenbewegungen von einem Computer. Besucher lösen durch Unterbrechung von Lichtschranken im Raum einen Trudelprozess der Kugel aus, indem der Zufallsgenerator jetzt die Parameter für die Drehrichtung, die Geschwindigkeit sowie die alternierende Versorgung der Motoren mit Strom ständig neu errechnet. (...) Die Kugel ist mit Graphit beschichtet und zeichnet ihre Bewegungen durch Reibung und Schleifen der drei Auflagepunkte auf die eigene Oberfläche. Die Spuren werden immer wieder fragmentiert, überschrieben und neu gebildet. Diesen Prozess kann man in der simultanen Grossprojektion mitverfolgen. Die Kugel wird von einer Lichtquelle in horizontaler Richtung angeleuchtet, so dass sie an der Wand dahinter einen Schatten erzeugt.» Methodisch scheint es das umgekehrte Verfahren zu Fischli Weiss zu sein, hier wird scheinbar mit der grossen Kelle angerichtet, wird ein Technopark in Betrieb gesetzt, der stärker einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung denn einer künstlerischen Arbeit gleicht. Doch das stimmt so nicht: Weder sind die Geräte auf dem letzten Stand der Entwicklung, noch verlässt die Installation den mit Scotch-Bändern verklebten Stand der Improvisation. Rickli haben immer die Parallelen der Erkenntnis- und Wahrheitsfindung in Kunst und Wissenschaft interessiert. Seine «Schreibspiel» genannte Installation ähnelt stark einer wissenschaftlichen Vorrichtung zur Erzeugung gesicherter Wahrheiten. Er unternimmt auch eine Reihe der üblichen Auswertungen, der Vermassungen, der Abwicklung der Kugel auf Millimeter-Papier, und er lässt bestimmte Durchschnittswerte errechnen: Aufzeichnungen, die letztlich durch die Versuchsanordnung vorbestimmt sind. Das wirkliche Erproben der Erkenntnismöglichkeiten wandelt sich zum ironischen Spiel mit der Prädisposition. Was bleibt sind Einsichten in die Relativität – und verführerisch schöne «Planeten»-Bilder!
Laurent Schmid macht die Tücke zum Objekt, wandelt den Fehler zum Verlangen, macht «Partisanen» zu Hauptdarstellern. «Partisanen» werden im Druckprozess Schmutzteilchen auf der Platte genannt, die im Raster einen schwarzen Punkt mit heller Aura erzeugen. Schmid hat eine Reihe von Arbeiten mit diesen berufsethischen Schandflecken vorgelegt. Die hier vertretene Arbeit, «Lichtenbergsche Figuren», aus der Serie «Elektrisieren auf Bergen», setzt dieses Thema fort. Bei extrem trockener Luft können beim Filmtransport elektrostatische Entladungen vorkommen, die sich in Blitzen auf dem Film manifestieren. Schmid mischt nun dieses Fehlverhalten mit Bildern eines spanischen Elektrizitätswerkes und mit Stadtbildern – mit dem Kraftwerk und dem Kraftverschlinger. Realvorgang und Repräsentation zum selben Thema überlagern sich auf der gleichen Schicht. Der Verweis auf Georg Christoph Lichtenberg, den Physiker und Literaten, verstärkt den spöttisch-ironischen Aspekt und damit auch die gedankliche Verbindung von Kaminrohren und elektrischer Energie mit sexuellen Trieben.12
Bildfeier
Am Ende aller Forschung, Zweifel und Infragestellungen stellt sich wieder die Ursituation ein: Hier der Künstler, die Künstlerin, dort das Bild, später ein paar Betrachter. Aber die Situation ist eine andere, weil getränkt mit medialem Wissen, gestärkt durch den Umweg über die Methoden-, Mittel- und Erkenntnisforschung. Cécile Wick ist eine jener Künstlerinnen, die sich schliesslich einer Ursituation verschrieben haben: Einfache Kamera (dass es eine Lochkamera ist, bleibt nebensächlich), einfache Wege, einfache Bilder: Landschaften, von Seen, Meeren, von Bergen, Wasserfällen, vom Rheinfall – und Kopf-(Selbst-)Bildnisse. Einzelbilder, die sich leicht, fast modular, zu Gruppen vergrössern lassen. Aussenwelten und Innenwelten als ein Gemeinsames, als ein reiches Schwarzweiss, ein dichtes Bild. In Katalog und Ausstellung sind es vier Horizontbilder, in denen die Räumlichkeit fast aufgelöst, fast in die Fläche gerückt ist. Eigentlich sind es zwei Flächen, die aneinanderstossen, nichts weiter. Wir, die Betrachter, geraten ob diesem reichhaltigen, verführerischen Nichts allenfalls ins Projizieren, ins Schwärmen.
Bei Cécile Wick hält der Horizont Repräsentation und reine, abstrakte Bildlichkeit noch in der Waage, bei Adrian Schiess, Maler – anfänglich mit eigener Betonung auf «Flachmaler», auf «Zeitverstreichungsmaler» –, löst sich die Repräsentation in seinen kleinen, 30 x 50 cm grossen Farbfotografien ganz auf. Da war einmal etwas vor der Kamera, ein Fussboden, ein Bildschirm, doch die Art der Aufnahme, vor allem die unterschiedlichen Grade an Unschärfe, verwandelt die prosaischen Vorlagen in feierliche Abstraktionen, in zarte Verläufe oder bunte Flecken. Das reine schöne Scheinen ist materialisiert und ist waagrecht oder senkrecht, aufrecht oder auf dem Kopf stehend zu hängen, denn es ist ein von vielen Ordnungen losgelöstes rechtwinkliges, freischwebendes Stück Fotofarbe, auf Aluminium aufgezogen, und soll schliesslich an die Wand - und nicht, wie bei Adrian Schiess üblich, auf den Boden - plaziert werden.
Inszenieren und Konstruieren
Fischli Weiss' Einführung der erzählerischen Bildkonstruktion findet seit 1984 bei Christoph Rütimann eine Parallele. Der Luzerner Künstler, bekannt für sein Schaffen in vielen verschiedenen Medien, bekannt auch für seine gedanklich und gestalterisch präzisen Arbeiten, die im wesentlichen um das Thema offener, floatender Energien streifen – Energien, die sich dann und wann zu Flüssen verdichten, die sich niederschlagen, Ausfällungen produzieren, als Gewicht auf der Waage, als Linie auf der Wand, als Kurve im Raum, als seismographische Notate auf Papier –, dieser Christoph Rütimann lebt seine poetische Seite vielleicht am stärksten in seinen Polaroid-Arbeiten aus, die er in manchen Winterferien tatsächlich im Schnee inszeniert hat. Die neueste Serie, 42 Polaroids, 42 verschiedene Szenen, Geschichten im Schnee, ist erzählerischer, theatralischer denn je. Man gewinnt den Eindruck, der Schnee bilde eine hervorragende, halbdurchscheinende, hallbpräsente Bühne für die verschiedensten Bildgeschichten, Bildrätsel, Bildspiele. Kleine szenische Stücke, teils mitintegriert das eigene und das Bildnis seiner Freundin, die aus lauter Fragmenten von ausgeschnittenen Fotos, Hölzchen, Stäbchen, Klebband ein schönes rätselhaftes Bild-Gewebe inszenieren, zum Beispiel eine Art wunderbarer modellhafter Gartenanlage, mit Gebäuden aus gelben, roten oder grünen Bausteinen vor quadratischen Teichen in tiefem Blau. Verkehrte Grössenverhältnisse, fragmentierte Figuren und Wörter, reale Gegenstände und ausgeschnittene Fotofiguren entfachen zusammen einen poetisch-bildnerischen Zauber.
Bernard Voïta ist strenger in seinen Fotografien. Er konstruiert wie Rütimann alles bis zum letzten, doch seine Intention ist weniger das Theatralische als das Skulpturale, das Bildhauerische. Hat er in früheren fotografischen Aufbauten mit der Bildfläche und der Raumtiefe, mit dem Glanz der Wiedergabe und einem Raster als Bildordnung gespielt, so sind seine neuen 'Bild-Skulpturen' architektonischer. Sie sind ein Gang durch Architekturen und Städte, entlang der Autobahnen, an einer Tankstelle vorbei, ein Innehalten vor Häusern im Bau, bevor es ins Freibad geht. Die kleinen und mit viel Weissraum umgebenen Fotografien sind wie vergrösserte Rasterpunkte, kommen wir jedoch näher, dann öffnet sich darin ein ganzes Universum. Der Homo ludens ist bei Voïta immer zu spüren, aber auch die Liebe zur perfekten Konstruktion. Fiktionen mit dem Geschmack von Realität.
Prägungen – Bild und Sprache
Bild und Sprache überkreuzen sich, kommen sich in die Quere oder ergänzen sich zu einer erweiterten Dimension in den Arbeiten von Ian Anüll und Daniele Buetti. Anülls Grazer Arbeit, die vier Diptychen aus je einer gleichbleibenden monochromen Malerei und einer sich verändernden, sich entwickelnden Fotografie, ist ein sarkastisches Stück Kunst. Am richtigen Ort – in der Steiermark –, an der richtigen Hauswand – jener eines Fotoladens – spielt sich vor den «Augen der Fotografie» der Kampf ab zwischen Symbol (Hakenkreuz) und monochromer Farbfläche, zwischen einer knappen, trockenen, emotionsentleerten Aktivität und einer vor Zeichen und Bedeutung triefenden «Bündelei» – oder gewagt formuliert: zwischen der Moderne und der Blut- und Bodenideologie. Anülls Arbeit mit den Schrifttafeln «Stil», «Style», «Estilo» etc., über die Jahre auf Reisen jeweils in der Landessprache und einer dem Land zugeordneten Farbe gemalt, provoziert heftige Gegensätze und wilde Assoziationen. Der Begriff «Stil», in sich schon traditionsbeladen und problematisch – vom kleinen Unterschied bis zum «international style» –, und von einem reisenden Europäer als Schrifttafeln in die verschiedensten Kontexte plaziert, bewirkt kleinere Konnotationsbomben: zwischen Bild und Sprache, Strassenszene und gepflegter Kultur, zwischen Nord und Süd, Ost und West, Lebensstil und Lebensrealität, zwischen Stil und Stil. Die Aufbereitung als idyllische Bildchen auf Leinwand verschärft die Konflikte noch.
Aussen- und Innenhaut: Daniele Buettis zwei wandbedeckenden Arbeiten «Please justice» und «Good fellows» gehören strukturell zusammen. «Please justice», diese 54teilige, in sich panoramaartig angelegte Fotoarbeit, kombiniert zwei äussere Erscheinungsbilder, jenes der Stadt (New York) und jenes der öffentlichen Sprache – Stadtbild und bildhafte Typographie. Beide Ebenen vermischen sich unterschiedlich stark, doch aufs Ganze gesehen «siegt» optisch die Sprache, die Überformung der Welt mit Anweisungen, Modellen, Befehlen. Man ist versucht, mit den vielen fotografisch-typographischen Einzelarbeiten zu spielen, sie neu zusammenzusetzen, zum Beispiel eine Entgegnung zu «Please»/«justice» zu finden: «Accept»/«your»/«life» oder «We make»/«You», wieder anders: «We»/«deserve»/«you» und so fort.
«Good fellows» dagegen verengt den Raum, verschiebt die Trennzone – hin zum letzten Refugium des Individuums, der eigenen Haut, des Armes, Beines oder, noch «näher», der Brust. Angefangen hat die Arbeit in New York, als Performance, als Markthandel: die Tätowierung auf der Strasse; ihre Fortsetzung fand sie in der Überblendung von Bild und Sprache, vom Nächsten und vom Fernsten, von kleinster Öffentlichkeit (der eigenen Haut) und grösster Privatheit (den Namen übernationaler Mega-Companies), in der Tätowierung gegenseitig «verkeilt». «Buetti markiert mit seinen Firmen-Tattoos präzise jene Schnittstelle zwischen kollektiver Vereinnahmung und individualistischer Selbstbehauptung.»13 – die Schnittstelle mit Kreuzstich zum schmerzhaften Paradox vernäht.
«Nach der Natur» 14
Gérald Minkoff hat die Aneignungspraxis eingeleitet, Rémy Markowitsch macht sie zum zentralen Teil seiner künstlerischen Haltung. Er vertieft sich in Bilderbücher, in kollektive Bilderarchive des 20. Jahrhunderts, in Pflanzenbücher der fünfziger, Ertüchtigungsbücher der dreissiger Jahre, in den Umgang mit Bildern, ihre Anordnung, Abfolge, und in ihre Drucktechniken. Sein grosses Projekt heisst «Nach der Natur» – zeitlich 'nach', aber entfernt, losgelöst von der Natur – und enthält die Unterkapitel Landschaften, Pflanzen, Tiere und Menschen. Wie viele seiner Werke so funktioniert «Nach der Natur» nach folgendem Prinzip: Markowitsch behandelt das vorgefertigte Kulturgut wie ein Rohprodukt, stellt es ins Licht, das heisst, er durchleuchtet es, lässt zwei Bilder der gleichen «Art» sich gegenseitig überblenden. Resultat: Seine mechanische Kopie einer mechanistisch gedruckten Kopie einer mechanistisch fotografierten Kopie einer Realität wird selbst wieder zu einer eigenen, teils monströsen Bildrealität, zur Neuschöpfung – ähnlich den Neuschöpfungen der Menschheit im Material-, Pflanzen- und Tierbereich. Markowitsch spielt in der Bildkultur die Rollen des Archivars, des Chronisten und des Mephistopholes, des teuflischen Neuschöpfers, zugleich.
Zum Schluss Martin Blums Bildkonstruktionen, die das ganze nun zur Verfügung stehende Instrumentarium einsetzen: Abziehen des Bildes vom Träger, Ausschneiden des Bildes und plastisch-räumliche Anordnung, Rollen des Bildes, in die Ecke, in den Raum stellen, Verwendung von vorgefundenem, gedruckten Bildmaterial, Vermischen von Bild- und Nichtbildmaterial – und schliesslich Licht- und Schattenwurf: sie erzeugen, wo gewünscht, Räumlichkeit, Tiefe. Und diese Mittel sind so eingesetzt, dass man, spätesten beim zweiten Blick, das Konstrukt erkennt, seiner Vielfältigkeit folgt, in Wahrnehmungsabgründe eintaucht. «Zwei Wirklichkeiten und zwei Dimensionen prallen aufeinander: die grossräumige des auf dem Foto Dargestellten, und die kleinräumige des manuellen Eingriffs. Stechend, schneidend, reissend und knickend wird diese 'grosse' Wirklichkeit 'korrigiert', und ein neues Bild entsteht, das tatsächlich fast 'wahr' sein könnte, weil der Eingriff sich auf das Dargestellte im Foto bezieht, dieses imitiert. In der Vermittlung, Verzahnung, im Aufeinanderprallen dieser Dimensionen liegt auch der Humor dieser Arbeiten begründet, gleichzeitig allerdings auch eine Schärfe, Härte, weil die 'kleinen' Eingriffe mit ihren 'grossen' Auswirkungen häufig Verletzungen, Zerstörungen gleichkommen.»15
Vierzehn Positionen aus einem Feld, in dem das Bild als fester, sanktionierter Wert in Frage, auf die Probe gestellt und später in spielerischer, erzählerischer, feierlicher Form neu installiert, neu präsentiert wird. Nicht mehr mit absoluten Ansprüchen versehen, aber gerade wegen seiner Fragilität, seiner Brüchigkeit, seiner Künstlichkeit, seinem Humor und seiner Ironie als zeitgenössische Lebensmetapher geeignet. Gegen Ende des Jahrzehnts wird sich der Wandel in Politik und Wirtschaft klimatisch deutlich in Werken der Kunst zeigen. Wird tatsächlich die Ethik zurückkommen, wird es tatsächlich auch in der Kunst wieder ernst? Oder überschlägt sich die Zukunftsangst im Salto von Zynismus und Fatalismus?
1 Filippo Tommaso Marinetti, Zerstörung der Syntax – Drahtlose Phantasie – Befreiende Worte – Die futuristische Sensibilität, 1913, in: Umbro Appollonio, Der Futurismus, Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revolution, 1909-1918, Köln 1972, S. 119 ff.
2 Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose Welt, übersetzt von Hans von Riese, Köln 1962, S. 194
3 Max Bill, zit. nach Willy Rotzler, Konstruktive Konzepte, Zürich 1977, S. 130
4 Richard Paul Lohse, zit. nach Willy Rotzler, Konstruktive Konzepte, Zürich 1977, S. 136
5 2. Buch Moses, 20,4, "Du sollst dir kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist ..."
6 Beat Wyss, Nach der Moderne – die Schweiz z.B., S. 38, in Kunstszenen heute, Ars Helvetica XII, Hrsg. Beat Wyss, Disentis 1992
7 Titel einer gemeinsamen Ausstellung, Mannheimer Kunstverein, 1982, S. 91 ff.
8 Theo Kneubühler, Kunst: 28 Schweizer, Luzern 1972, S.3
9 Siehe auch: Urs Stahel, Brennpunkt 1980, in: Beat Wyss: Kunstszenen heute, Distentis, 1992, S. 91 ff.
10 in. Hugo Suter, Rolf Winnewisser: A Wheel in a Wheel, Katalog der Ausstellung im Swiss Institute in New York, 1992
11 Hugo Suters Kunst wird an verschiedenen Stellen mit dem Begriff "visuelle Denkprozesse" bezeichnet.
12 Konrad Bitterli, Störfälle und Fehlstellen, in: Katalog "Laurent Schmid", Kunsthalle Bern, 1995. S. 13
13 Christoph Doswald, All over. Mimetische Subversion in der künstlerischen Praxis von Daniele Buetti, aus einem unveröffentlichten Projektpapier, 1995
14 Titel des gleichnamigen Kataloges von Rémy Markowitsch, Galerie Urs Meile, Luzern, 1993
15 Simon Maurer: Martin Blum, Angehaltenes Misstrauen, in der Broschüre zur Ausstellung mit Gernainne Frey, Martin Blum und Mario Sala, Kleines Helmhaus, Zürich, 1995