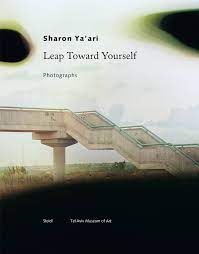Es begann alles mit einem Zweifel. Dem Zweifel an der Fotografie, an ihrer Fähigkeit zum Zeitgenössischen, zum Diskurs. Sharon Ya‘aris erste Arbeiten brachen deshalb die Einheit des fotografischen Bildes auf, er versetzte israelische Landschaften mit Bildern, die er im Abfall gefunden hatte, Fotografien von Osteuropa, von jüdischen Gemeinden in Pinsk und Turike – Ereignisse, Eröffnungen von Schulen, Spitälern, Emigrationen nach Amerika oder Palästina. Mittels Photoshop extrahierte er Porträts aus dem Found Footage, schob die Porträts aus der Vergangenheit mit Landschaften aus der Gegenwart zusammen und verschweisste sie zu neuen Bildrealitäten. Ein anderer Zustand, eine neue Zeit entstand, fragil, weil er Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Hoffnung zusammensetzt, weil er, wie ein Zauberlehrling, neue Präsenzen schafft.
Die durch digitales Collagieren, Montieren erzeugte Mehrzeitigkeit, Mehrschichtigkeit schmolz in den nachfolgenden Farbarbeiten wieder in einem einzigen Bild zusammen. Jeweils eine Aufnahme nur, aber so gerichtet, dass sie selbst ihre möglichen Bedeutungen aufbricht, dass sich einzelne Wahrnehmungen gegenüberstehen und herausfordern. Gruppen von Menschen, Familien vielleicht, sind in einer Fotografie unterwegs zum nur wenige Tage dauernden Schauspiel der blühenden Irisfelder. Doch es wirkt so, als seien sie unterwegs zu einem Begräbnis, zumindest zu einem Familientreffen mit besonderer Tragweite. Farbige, ja bunte und, obwohl sie verwaschen, verstaubt sind, schrille Plastikstühle mit Ausstanzungen an der Rücklehne, die einem Paar Lungenflügeln gleichen, damit das Sitzen auf Plastik in sommerlicher Hitze nicht so schweisstreibend ist, heitern den Blick, das Gemüt in einem zweiten Foto so lange auf, bis sich im Farbengewirr klärt, dass wir in einen Begräbnisraum schauen. Die Anordnung der Stühle im einfachen Raum liest sich wie das Mobiliar einer Familienaufstellung. Drei jungen Frauen, fast identisch in unten ausgestellten Jeans und sommerlich knappen, schulterfreien Oberteilen gekleidet, schauen wir zu, wie sie durch eine Wellblech-Abschrankung hindurch klettern. Eine der drei Frauen beugt sich bereits tief unter einer Metallstange durch, scheint den Schritt ins Nachtschwarze, in eine im Bild nicht erkennbare Welt zu wagen. Die spürbare Lockerheit des sommerlichen Flanierens kontrastiert mit der bildlichen Unklarheit, der Düsternis, dem sich öffnenden visuellen Abgrund. In einer weiteren Fotografie liegt, wie eine schwarze Zunge, Teer auf einem Waldweg. Drei, vier Zentimeter hingeschüttetes und ausgewalztes Bitumen. Die Zunge franst aus, denn es gab nicht mehr genügend Material. Mit falscher Zunge reden, heisst eine Redensart, hier scheint, wenn man genau «hinhört», eine Teerzunge im Wald vom Absurden in den kleinen alltäglichen Handlungen zu reden.
Sharon Ya’ari findet in diesen Farbbildern zurück zu einer einfachen, schauenden Fotografie. Eine direkt, aber behutsam beobachtende Fotografie, die Widersprüche, Mehrschichtigkeiten, Bedeutungsüberlagerungen in einen Rahmen packt und erst mit der Zeit wieder preisgibt. Er bleibt dieser Form von Fotografie bis heute treu, unterläuft sie aber laufend mit Fragen an das Medium, versetzt sie mit Reflexionen über das fotografische Sehen. Was wird mit welcher Absicht fotografisch gezeigt. Und aus welcher Position? Und wie? Und was zeigt sich darin? Gerade Erreichtes, Errungenes wird dabei ebenso in Frage gestellt, wie international Gefragtes, Angesagtes. Die Abkehr von der Farbe in der Fotografie war deshalb auch nur eine Frage der Zeit.