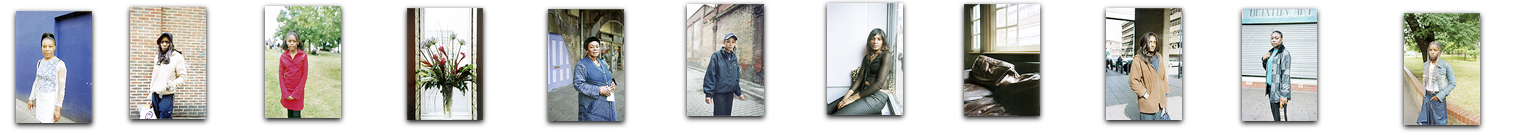Zuerst (die Künstlerin)
Jitka Hanzlová ist nach ihrer Flucht aus der Tschechoslowakei in den Westen durch einen jahrelangen Transformationsprozess gegangen, ohne genau zu wissen, wohin, in welche Zukunft. Es war ihr klar, dass sie die „eingeimpften Ängste“, das Funktionieren im Staatssozialismus loswerden wollte, aber ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, ohne das Gute, das Geschenkte, das sie in sich trug, aufzugeben. Gleichzeitig wollte sie sich schrittweise eine Existenz aufbauen, einen Raum, der sich in der Welt behaupten kann, Ideen, die sich realisieren und zeigen lassen können.
In unseren Gesprächen zeigte sie mir zwei Notizen, die sie vor längerer Zeit geschrieben hatte:
„Irgendwann anfangs 1983 bekam ich ein 9 x 7cm kleines Buch, voll mit Worten. Nur die Hälfte davon kannte ich. Es war ein Langenscheidts Wörterbuch, tschechisch/deutsch, deutsch/tschechisch.
Ich nahm es überall mit und begann darin zu suchen, auch wenn ich täglich zu Hause lernte, und versuchte aus dem Meer der Laute Worte herauszufischen – und zu übersetzen. Die deutsche Grammatik lag noch fern. Doch irgendwann, mit der Zeit, war das kleine, in Plastik gebundene Buch so zerfleddert und zerlesen, der Rücken offen, die weichen Buchdeckel ab, dass es auseinander fiel.
Es lag dann nur im Regal, denn vieles war nun in meinem Kopf einsortiert. Ich brauchte es nicht mehr. Es wurde zur Reliquie dieser Anfangszeit.
Inzwischen war ich Fotografie-Studentin und lernte auch Buchbindung. Es war das erste Buch das ich gebunden habe, in sandfarbenem Leinen, mit gelbem Kapitalband, nackt. Einige Jahre später fotografierte ich in Rokytník und holte mir Stück für Stück die Vergangenheit zurück, suchte meine fotografische Sprache, und – die Wahrheit.
Was ist das, die Wahrheit? Manchmal sah ich sie, da draußen, in den Wäldern, in den Bäumen, Gräsern und Hängen, dachte ich. An einem langen Winterabend klebte ich ein ausgeschnittenes Kontaktbild eines einsamen Birnbaums auf den Titel dieses Buches. Und schrieb darunter:
Die Wahrheit ist im Wald.
Ich glaubte es.
Das Buch war nun fertig.“[1]
„Zur Fotografie kam ich eher zufällig und doch folgerichtig; in einer Zeit, in der ich hier als Fremde nicht reden und verstehen konnte, und eine Zeitlang auf das Sehen, Hören und Beobachten angewiesen, ja fast existenziell dazu verurteilt war. Das Sehen wurde in dieser Zeit wieder zu meiner ersten Sprache. Ich parkte meine Erinnerungen und lebte auf einem Bein, begann zu zeichnen und kommunizierte durch diese Bilder per Post mit anderen und im Zwiegespräch mit mir. In dieser Zeit begann die Suche nach meinem DING, nach meiner Berufung. Nach einem Jahr kam über Nacht die Fotografie zu mir, ohne eine Kamera, ohne je zuvor ein fotografisches Bild gemacht zu haben: ich gab meinen Job auf und machte mich auf den Weg, auf die Suche, … wie? Ich fühlte, das ist mein Ding. Doch ich ahnte noch nicht, dass ich in einer Hochburg der Fotografie gelandet war, wo das Wort Folkwang großgeschrieben wird.“[2]
In der Folge
Einige Jahre später fotografierte Jitka Hanzlová in Rokytník und holte sich Stück für Stück die Vergangenheit zurück. Ihre persönliche Rückkehr zu einer entschwindenden Zeit. Eine Zeit, die sie zurücklassen wollte, aus der sie sich herausgetrieben hatte. Ja, das sozialistische Denken, das Staatsgefüge, diese merkwürdige Enge, dieses Delegieren von Verantwortung an das System. Und demgegenüber die drängende, überschüssige Energie, die Sehnsucht, das Leben. Anfang der Achtzigerjahre landete sie in Deutschland und kehrte eine Weile lang nicht mehr zurück. Weil es ihr verboten war, weil ihr der Zugang bei Strafe versperrt war. Nach der Wende 1989 das Pendeln von West nach Ost und zurück. Wohnort und Studienort in Essen, Heimat noch in Rokytník? Wohnort in Essen, Sehnsuchtsort in Rokytník, Heimat bei sich, alleine? Oder Wohnort und Aktionszentrum in Essen, Heimat im Dazwischen? Offene Fragen, die es fortan zu erkunden, Erinnerungen, die es aufzufrischen, zu ordnen, zu verstehen und zu bewahren galt. Sorgfältig, auf die Gefahr hin, überrascht, brüskiert oder wieder davon eingenommen zu werden. Jahrelang. Wohn-Haft in Essen, ist man, zeitweise, als Betrachter von aussen versucht zu schreiben.
Mit dem Wörterbuch begann ihre Suche nach der Sprache in der neuen Welt, ihre Orientierung, ihr Wunsch nach Bodenhaftung, nach dem Aufbau einer neuen Lebensform. „Es war das erste Buch das ich gebunden habe, in sandfarbenem Leinen, mit gelben Kapitalband, nackt.“ In der Folge hat Jitka Hanzlová praktisch jedes ihrer Bücher in Leinen gebunden, einfarbig, in je unterschiedlichen Farbtönungen. Ausnahmen sind „Female“, mit einer Fotografie, mit Schrift und Verlag auf dem Umschlag, sowie „Vielsalm“ und „Bewohner“, bei denen papierbezogener Karton gewählt wurde. In das Leinen oder die Pappe ist jeweils ein Wort geprägt: „Rokytník“. „Female“. „Bewohner“. „Wald“. „Hier“. „Horse“. „Vanitas“, und „Cotton Rose“, der Name einer Rose. Die Namen oder Bezeichnungen sind, manchmal mit metallisch glänzender Folie belegt, in das Leinen eingestanzt, sie sind aber in der Typographie und in der Schriftgrösse so fein und klein gehalten, dass das Klare, auch Leuchtende wie ein vorsichtiges Benennen wirkt. Die Heimat. Die Natur. Die neuen Nachbarn. Natur 2. Ein bedrückendes Hier und Jetzt, Vergänglichkeit. Felder der Begrenzung, der Bestimmung, der Existenz. Ja, Bereiche von Wahrheit auch. Wie erste und letzte Worte. Wie ein persönliches Alphabet. Nackt. Es sind hochformatige visuelle Notizhefte einer Wahrheitssuchenden. Sprache ist wichtig für Jitka Hanzlová. Auch im sprachlosen Zustand der Emigration, des Fremdseins in neuer Welt, das ihr Vermögen, ihren Sinn stärkt, die Welt in Bildern zu sehen, zu erkunden, einfach, präzise, das sie, wie sie schreibt, in die Fotografie geführt hat. In die Fotografie und ins Folkwang, in die damals berühmte Schule der Fotografie. Die Folkwang-Schule, die später dann in die Universitäts-Gesamthochschule Essen integriert wurde und heute Folkwang Universität der Künste heisst.
Rokytník
Ja, nackt, ausgesetzt. So wie die Kinder in „Rokytník“, die sich auf einer vom Sommerregen noch nassen Asphaltstrasse vorwärts robben, spielerisch suchend, erkundend, die Restnässe mit den Handflächen kostend und austestend. Austestend, ob sie Kriechtiere bleiben oder zum aufrechten Gang finden wollen. Nackt wie das junge Mädchen, das sich, verletzlich und forsch zugleich, an einer verrosteten Wäschestange abstützt und hinstellt. „Hier bin ich“, scheint es zu schweigen, selbst unsicher darüber, was das ist und sein wird. Nackt auch wie das geschlachtete Schaf, das, aufgeklappt an einer Eisenstange drehend, über dem offenen Feuer im Freien gegrillt wird. Die Kinder und Kleinkinder stehen für die Zukunft in diesem poetisch-melancholischen Gang durch das Heimatdorf Rokytník. Sie sind das Lachen, das Schauen, das Staunen, das Spielen, das Erproben, das Trotzen auch, das Behaupten, sich in der Welt Behaupten – unklar jedoch wie lange. Sie wirken in diesem Dorfporträt wie die Wiedergeburt, die Erneuerung, während die Erwachsenen, die Älteren, die Alten bei aller Gelassenheit wie die Holzpfosten von Zäunen eng an ihre Funktion geschraubt wirken. Sie gehen ihres Wegs, den sie sich gegeben haben oder der ihnen vorgeschrieben wurde, sie folgen den Pflichten. Selten nur wirkt bei ihnen der Brustkorb richtig frei, wirken sie durchatmend, leicht. Ihr Blick ist gerichtet, oft gesenkt, verhangen, er scheint zu wissen, wohin er in den kommenden Jahren noch schweifen darf. Kleine Augenblicke von Stolz, von Entspannung, Anflüge von verstecktem Humor, sonst Pflicht, der Lauf des Lebens halt, der Gang der Zeit. Gleichwohl, trotz dürrer, sich mit der Zeit ausdünnender Perspektive spürt man viel Einvernehmen mit dem Schicksal, viel Einsicht in die Notwendigkeit – der Lage, der Möglichkeiten.
Der Querschnitt durch das Dorf ihrer Kindheit wird ausgedehnt, das Synchrone in die Zeitachse, ins Diachrone gezurrt und gezogen, so dass sich ein räumlich-zeitlich, ein lebenszyklisch angelegtes Netz ausbreitet. Ein Feld, das von zwei Landschaftsbildern eingerahmt wird: zu Beginn die orangerote Wäsche über prallgrüner Sommerwiese flatternd, von der Sonne hellerleuchtet, am Schluss wiederum Wäsche, nun in Winterstarre, brüchig, draussen bei tiefem Neuschnee aufgenommen. Ein stilles und intensives Porträt zugleich, das den Jahreszeiten folgt, das Innen- und Aussenraum streng trennt, das mit Ausnahmen kaum Bilder von Innenräumen, dafür das Draussen, für die Kinder zumindest, als offen und weit zeigt. Das Porträt eines Dorfes, das seine Akteure nicht persönlich nennt, sie vielmehr zu einem sozialen, existenziellen Dorfpanorama vereint, mit bewusst gewählten Abfolgen von Bildern, von Porträts, Landschaftsbildern, von zwei seltenen Innenräumen, mit verschiedentlich Einsätzen von Leerseiten. Ein Dorfporträt, überlagert vom und vernetzt mit dem Selbstporträt der Fotografin.
Das Buch begründete die einsetzende und wachsende Aufmerksamkeit, die dem Werk von Jitka Hanzlová international zuteil wurde. Es war die erste Arbeit in der für ihr Werk so signifikanten Farbfotografie, diesen oft leicht untersättigten Farben, die dem Werk und der Welt in ihren Werken einen Hauch von Heiterkeit, von Leichtigkeit verleihen. Ausnahme ist hier lediglich die Aufnahme des geschlachteten Schweins, mit ihrem fast symbolträchtigen Glühen des Innenraums. Die Fotografien in Rokytník stecken schon sehr deutlich den eigenen, bestimmten Aufnahmeraum ab, den Jitka Hanzlová regelmässig fast schlafwandlerisch sicher absteckt und besetzt: Sie fotografiert direkt, fast schnörkellos, steht zu den Menschen oder vor sie hin, aber ihre Kamera hat nichts Konfrontatives. Sie ist da, begleitet die Situation, wirkt dabei fast wie eine Vertraute, eine Wegbegleiterin ihrer „Subjekte“. Sie steht da, klar, und lässt zugleich Raum für ein Geschehen.
Wald
Während Jitka Hanzlová in „Rokytník“ in ihr Heimatdorf zurückkehrt und dort eine Form von poetischem Soziogramm der Menschen und ihrer Gemeinschaft des auslaufenden kommunistischen Systems erstellt, eingeschlossen Teile ihrer eigenen Familie – Vater, Mutter –, kehrt sie im Buch „Wald“ in die „tiefe“ Natur ein. In den Ursprung ihrer Natur, den systemfreien Hort ihrer Kindheit. In den doppelten Wald neben dem Dorf, neben Rokytník, der Natur neben dem Gesellschaftssystem, dem Sein neben der Ideologie. In den leeren Wald voller Leben, leer von Menschen, fast leer von sichtbaren Tieren – sie verstecken sich –, aber voller Leben, Geräusche, voller wogender Wesen, den Bäumen, den Büschen, den rauschenden Blättern. Unterbrochen von Stille, wenn der gigantische Schalldämpfer Wald je nach Dichte der Bäume und Büsche alles aufzusaugen und zu schlucken scheint, für Augenblicke, für eine kleine zeitliche Dehnung, bevor auch in der Tiefe des Waldes das Leben wieder durchbricht. Sie tritt hier in den Wald, den allgemeinen, den Ursprung des Lebens, die Bewahrung des Lebens, in den Ausgangs- und Rückzugsort, in eine Form von ursprünglichem Dasein.
Als streife Jitka Hanzlová an ihrer sozialen Herkunft vorbei, lässt sie in diesem Projekt Rokytník neben, hinter sich und taucht in die grösstmögliche Nähe zur „Natur“ ein und ab. Wie bei „Rokytník“ und bei späteren Grossprojekten tastet sie sich dem gewählten Ort, dem gesuchten Thema langsam an. Fotografiert, probiert aus, schüttelt den Kopf, verwirft, startet neu, immer wieder, geht tiefer, noch tiefer. Über Monate und Jahre. Oft sind es fünf und mehr Jahre, bis sie die visuelle Sprache für das, was sie sagen, zeigen, vermitteln will, gefunden und ausgeführt, bis sie die Reihe der Bilder zusammengestellt hat, die für diese Not, diese Suche, dieses Sehnen, diese Dringlichkeit sprechen. Die Intensität des Suchens scheint einer existenziellen Notwendigkeit zu entsprechen. „Forest“ koaguliert in den Bildern von Jitka Hanzlová zu einem zentralen Ort, einer Art von säkularem Ursprungsort, von materialisiertem Unbewussten des Daseins. Als befinden wir uns im Auge des Hurrikans, im Zentrum der Winde, herrscht da oft Ruhe, Stille, Verlangsamung, er wirkt, wie gesagt, menschenleer, grosstierleer, kleintierleer – einzig sichtbar sind im Endprodukt ein Vogel und eine Spinne. Der Wald wird zur Gebärmutter, in der die Welt immer von neuem wiedergeboren, wiedererzeugt wird. Endlos, zeitlos. Zumindest, wie John Berger im Essay zu diesem Buch schreibt, fern der linearen, geordneten, produktiven Zeit, der Zeit als Fortschritt, wie wir sie seit 200 Jahrhunderten, seit der Industrialisierung des Lebens kennen.[3] Zeitlos oder zeitenvoll, mit totalem Schweigen, Windstille. Bedeckt und ruhend im Winter. Glühend im Blick durch Blätter auf eine hellerleuchtete Lichtung. Kaum Richtung, kaum Wegstrecken, als kreisten wir in diesem Buch letztlich immer um ein unsichtbares Zentrum.
Die Bilder lese ich über weite Strecken, als tauchen wir ins Unbewusste der Natur ab, in einen Urklang, sofern es ihn gibt, an den Ort, aus dem das Leben auf der Erde seine Kraft bezieht. Wir gleiten beim Blättern durchs Buch in einen Dämmerzustand, wir reiben uns die Augen, beginnen im Halbdunkeln den Spuren zu folgen, den nur halblesbaren, verstehbaren Zeichen, dem struppigen Gras, erschrecken ob dem Leuchten des Lichts auf einer Lichtung, der erstaunlichen Aufhellung des Waldes bei Schnee, sinken wieder ab ins Halbdunkle, Ganzdunkle. Emanuele Coccia, der italienische Pflanzenphilosoph spricht davon, dass „Pflanzen die radikalste Form des In-der-Welt-Seins“ sind, sie seien offen, geduldig, standfest, grenzenlos, sie wirkten, ohne zu handeln.[4] Er setzt in sein Buch „Die Wurzeln der Welt: Eine Philosophie der Pflanzen“ auch die Aussage: „Dank den Pflanzen wurde die Erde zum metaphysischen Raum des Atems.»[5] Dabei hebt er das Blatt in den Himmel, als Zentrum von Stamm und Wurzel. Pflanzen sind in seiner Vision «eine Maschine, die die Erde an den Himmel bindet». Um mit dem Statement zu schliessen: «Alle Körper, einschliesslich jener des Menschen, sind letztlich Transformationen des Lichts.»[6] Der Wald und seine Nadeln und Blätter werden so zum grossen Generator, zum Transformator, der der Welt Licht und Kraft einhaucht, der das Dunkle belebt, „beseelt“. In Coccias Denken ist von dieser radikalen, permanenten Wechselwirkung die Rede, die wir in den Waldbildern von Jitka Hanzlová spüren. „Denn bleiben ist nirgends“, zitiert die Künstlerin Rainer Maria Rilke aus seinen „Duineser Elegien“, und spielt auf die Bewegungen des Lebens, vielleicht auch auf die Suche nach „Hier sein ist herrlich“ an, nach den „Adern voll Dasein.“[7]
In jedem Fall geht es ihr zumindest um die Suche nach ihrer Wahrheit, vielleicht auch nach der Wahrheit für uns alle. Und umgekehrt gesprochen: In „Forest“, in diesen oft dunklen, saugenden, in einigen Beispielen abstrakten und auch rumorenden Bildern spüren wir Betrachtende die intensive, tiefe Suche von Jitka Hanzlová nach Essenz, nach dem Kondensat des Lebens, nach Dingen, die Bestand haben.
Horse
Zehn Jahre nach „Forest“ erscheint „Horse“. Der Titel des Buches ist farblos und grösser als bisher eingeprägt in ein curryfarbenes Leinen, die Abstände zwischen den Buchstaben sind gespreizt, als halten die einzelnen Buchstaben – H-O-R-S-E – bruchstückhaft die Eckpunkte eines Geheimnisses fest: das Geheimnis des Pferdes. Ein höchst ungewöhnliches Projekt im bisher grössten Buchformat. Wie kann man sich als seriöse Künstlerin dem Thema „Pferd“ annehmen, war ich einst versucht zu fragen. Dem Traum vieler junger Mädchen, dem Verkaufsargument jedes Fotokalenders. Und dann schaute ich dem ersten Pferd in die Augen, dem nächsten ins Gebiss, den weiteren aufs gespitzte Ohr, auf den Schweif, auf die unterschiedlichen Haltungen. Beobachtete sie beim Pissen, beim Horchen, beim Spielen, beim sich in den Sand Werfen, vielleicht um den Rücken zu reiben, beim simplen und doch markanten einfachen Dastehen, nichts weiter. Schaute mich durch das ungewöhnlichste Buch von Bildern von und mit Pferden, von Blicken auf Pferde, von Blicken von Pferden auf uns.
In der für Jitka Hanzlová eigenen Art hat sie sich auch hier wieder über Jahre, in diesem Fall über acht Jahre hinweg mit den Pferden, mit den Bildern von Pferden beschäftigt, hat sich Schritt um Schritt über eine lange Zeit von herkömmlichen Pferdedarstellungen entfernt und sich selbst und uns Betrachter den Bildern einer anderen Natur, dem Wesen, den Handlungen von Pferden angenähert. Sie führt uns die Pferde in einer Natürlichkeit vor Augen, dass wir für Augenblicke immer wieder vergessen, dass es sich nicht um wilde Pferde handelt, sondern dass wir hier sehr besondere, intime Momente das Pferdseins im Kontext von uns Menschen erfahren. Jitka Hanzlová ist geradezu eine Pferdeflüsterin. Ihr Zugang zu diesen Wesen ist ungewöhnlich, direkt, nah. Die Kommunikation scheint sich fast spielend einzustellen. Sie gewinnt schnell das Vertrauen der Tiere. Die Art der Bewegungen, die sie vor und mit den Pferden ausführt, die Langsamkeit der Berührungen, des Redens, scheint die Pferde schnell zu beruhigen und erhöht die Bereitschaft, sich aufmerksam, aber ruhig dieser Person zuzuwenden. Diese Nähe spüren wir in den Bildern, diese Selbstverständlichkeit auch, diesen Respekt dem Tier als einem Wesen für sich gegenüber. Nicht nur als einem Wesen für den Menschen, als Haustier, einer verfügbaren Natur, als Nutzpferd, Rennpferd, eines Nahrungslieferanten, als Pferdefleisch. In vielen der Fotografien zeigt sich das Pferd bei sich, für sich, mit sich selbst beschäftigt, und nicht ausgerichtet auf den Menschen, und gleichzeitig wirkt es auch nicht abwesend, wie das Zootiere an sich haben.
Der englische Kultur- und Kunstessayist John Berger hat unter dem Titel „Warum sehen wir Tiere an?“[8] vor bald vierzig Jahren eine kleine Tierphilosophie geschrieben und sich darin gefragt, wieso wir Tiere anschauen, ob wir sie wirklich anschauen, und wenn, dann weshalb? Er formulierte: „Die Tiere kamen aus dem Land hinter dem Horizont. Sie gehörten dorthin und auch hierher. Sie waren ebenso sterblich wie unsterblich. Das Blut eines Tieres floss wie Menschenblut, aber seine Gattung starb nicht aus, jeder Löwe war Löwe und jeder Ochse war Ochse. Dies – vielleicht der erste existentielle Dualismus – spiegelt sich im Umgang mit den Tieren. Sie wurden unterworfen und verehrt, gezüchtet und geopfert.“[9] Schrittweise haben die Tiere in der Geschichte der Menschen diesen Status des Anderen verloren, durch die Trennung von Körper und Seele wurden sie seit Descartes zu seelenlosen Wesen, zu Maschinen degradiert, die dem Menschen dienen. Der althergebrachte Zoo ist dafür ebenso sehr Symbol und Beispiel wie die Tierfabrik. Überall verschwinden die Tiere schrittweise als ebenbürtige Natur aus dem Blickwinkel der Menschen. Sie verlieren an Aufmerksamkeit und werden nur noch genutzt. In den Zoos seien sie das lebende Monument ihres eigenen Untergangs geworden, schreibt Berger. In der heutigen Zeit die Realnahrung und die Bildnahrung, mit den Millionen von Katzenfotos und Pferdefotos im Internet: „Das ist die letzte Konsequenz ihrer Verdrängung. Dieser Blick zwischen Tier und Mensch, der vielleicht eine der wesentlichsten Rollen in der Entwicklung des Menschen gespielt hat, wurde ausgelöscht.“[10]
Das Tier wird in dieser Entwicklung nur noch als das Beobachtete gesehen, das Angesehenwerden des Menschen durch das Tier hat seine Bedeutung verloren. Einzige Ausnahme: die Haustiere. Genau das ist im Buch „Horse“ umgekehrt oder zumindest sich gegenseitig ergänzend. Ja, Jitka Hanzlová schaut, sie lässt sich aber auch anschauen. Das ist sichtbar, spürbar, selbst in den Bildern, in denen sich die Pferde nur mit sich selbst zu beschäftigen scheinen. Das ist auch die ungewöhnliche Kraft der gewählten Ästhetik in diesem Buch, in diesem Projekt. Wir sind als Betrachter immer sehr nahe bei den Tieren, riechen manchmal fast ihre Ausdünstung, meinen ihre Mähne streicheln, den Pferden in den Mund fassen zu können. Und dann tritt Jitka Hanzlová zurück und beobachtet das Pferd von weitem, fotografiert, wie es einen Tanz aufführt, vor ihr, vielleicht für sie, wegen ihr. „One To One“, wie eine Ausstellung bei Yancey Richardson 2015 in New York betitelt worden ist. Das verweist auf die unmittelbare Spiegelung des Menschen, seiner Stimmungen, seiner Energie, seiner Nervosität durch das Pferd.
Die Heimat – das Dorf, die Menschen, die Eltern –, der Wald – ein grosses Stück belassene, wenig genutzte Natur, pflanzlicher Urgrund – und das Tier – in diesem Fall das Pferd: das lese ich wie eine Trilogie im Werk von Jitka Hanzlová. Eine Trilogie, die sie machen musste, auch wenn es ihr wohl nicht von Anfang an bewusst gewesen ist. Eine Trilogie, so kann man vermuten, die stark auch mit ihrer Emigration, ihrem sich Loslösen aus der „Heimat“ zu verbinden ist. Drei tief verankerte Säulen des fotografischen, des emotionalen, des existenziellen Daseins.
Bewohner & Hier
Meine Betrachtung folgt nicht der Reihenfolge, in der die Projekte entstanden sind. Jitka Hanzlová publizierte nach „Rokytník“ die „Bewohner“, dann „Female“, „Vielsalm“, „Forest“, „Hier“, „Horse“, „Vanitas“ und „Cotton Rose“. „Bewohner“ und „Hier“ lesen sich wie Gegenentwürfe zu „Rokytník“, „Forest“ und „Horse“, wie Gegenbilder, in gewisser Weise wie Bilder aus einer anderen Welt. Sie wirken nicht gefüllt und genährt wie die vorhin beschriebenen Projekte, sondern karg, verschlossen, steif, geometrisiert wie die urbane, nutzbare Struktur, sie wirken nicht wirklich farbig, sondern oft gräulich, nicht saftig, sondern blass. Der Umschlag von Bewohner ist blaugrau, das Wort selbst ist kleingeschrieben, als traue die Künstlerin diesem Wort noch nicht richtig. Die Bildreihe setzt ein mit einem diesigen Winterbild von Berlin in der Nähe des Alexanderplatzes. Es ist Schnee gefallen, die Autos pflügen sich in Schlangen durch das Weiss. Wenig Licht fällt durch den Nebel, die Wolken auf die Szenerie. Das Bild stimmt für den Rest des Buches den Klang an. Dann ausgelaufenes Benzin auf dem Strassenbelag, die abweisende fensterlose Fassade eines Bürohauses mit einem Fenster und missglückter Farbgestaltung, ein seltsamer Reisebus, Jungbäumchen als Rekultivierung von durch Tagebau umgepflügten Landflächen, ein Flugzeug vor dem Start oder nach der Landung, wiederum in diesem fahlen Licht, ein schräg wachsender, leicht bemooster Baumstamm vor einem kargen Haus. In der Mitte des Büchleins die Aufnahme von einer weissen Innenwand, mit beschriftetem Schmuckteller und einer Pistolenattrappe, die übereinander aufgehängt sind. Der Teller sagt trocken-pragmatisch: „Arbeit ist der beste Trost“. Zum Schluss dann eine zerzauste, blattlose Sonnenblume im Topf auf einem Tisch, aufrecht und gerade wie ein Holzstecken. Dazwischen Porträts, in denen das Bemühen der Fotografin und das Bemühen der Porträtierten Hand und in Hand gehen im Versuch, ein anständiges, wenn möglich unverkrampftes Bild abzugeben. Ein radschlagender Pfau im Käfig als Kontrast und ein Pinguin, dessen Freiheitswille am dicken Aquariumsglas scheitert. Die Machtverhältnisse scheinen klar zu sein.
In „Hier“ zieht sich diese Stimmung weiter, verdichtet, verdickt sich. Geometrische Flächen ziehen sich durchs Buch, eine Mauer schneidet die Sicht auf ein Haus in der Mitte durch, Hochspannungsleitungen führen dem geregelten Fussballfeld entlang. Haustüren stehen festverschlossen wie Festungen, wie Panzertüren da, ein Baumbusch quält sich zwischen Boden und Decke ein, von der Luftverschmutzung eingeschwärzte Birkenstämme kreuzen sich wie Giraffenbeine vor einer verkohlten Hausfassade. Blattlose Astgewirre überziehen die Bilder wie geflickte Fassadenrisse, Grau in Grau oder Rotbraun vor Kohlrabenschwarz. Und die Rollläden sind meist geschlossen.
Es ist auffallend, wie stark die Fotografin in diesen Bildern, die alle im weiteren Ruhrgebiet aufgenommen worden sind, mit der Geometrisierung von Natur, von Lebensräumen spielt, mit dem Thema der Einschränkung, der Beschränkung, der grauen, düsteren Verschlossenheit, einer Form von gebauter, verankerter Verbissenheit. In „Hier“ schauen die Jugendlichen so ernst wie die Erwachsenen. Die Rolle des bunten Pfaus, des traurigen Clowns spielt in diesem Buch schüchtern und unsicher ein jüngeres geschminktes Mädchen im hellblauen Tütü. Fastnacht darf sein, Fastnacht sogar im Mai vor blühenden Büschen. Wenn auch nur als Ausnahme, für ein paar Tage wie vor der Fastenzeit. Danach wieder Funktionieren, Zooverhalten, Grauzone. Mit wenigen Ausnahmen, die das „Hier“ machbar, lebbar, nutzbar machen, gefriert uns Betrachter, Betrachterinnen das Blut in den Adern. Die „Unwirtlichkeit unserer Städte“[11], des Lebensumfelds hat sich in „Hier“, in den Gegenden, die das Buch spiegelt, über Jahrzehnte verschärft und gleichsam in die Körperhaltungen eingefräst. Von oben zerbombt im zweiten Weltkrieg und anschliessend für die Braunkohle kräftig untergraben. Selbst Laub ist nicht beige, braun, gelb, rötlich, sondern schimmert metallgrau, kohlegrau. Das Kupfer des in Leinen eingeprägten Titels spiegelt sich im Innern des Buches im Bild einer Haustüre, die vollständig aus Kupfer gearbeitet und verschlossen ist. Sie scheint festzustellen: Hier Geld, hier Vorsicht.
Female
Es ist für mich als Betrachter erfrischend, nach „Hier“ das Buch „Female“ aufzuschlagen und langsam durchzublättern. Das Buch ist, wie einige von Jitka Hanzlová, im Tafelformat gehalten. Die linken Seiten sind weiss und leer, die rechten Seiten zeigen, unten mit etwas mehr Weissraum, Porträts von Frauen. Eines nach dem anderen, aus vielen Teilen der Welt. Immer schauen sie in die Kamera, oft sind sie im amerikanischen Schnitt („american shot“) kadriert, das heisst, ihr Ausschnitt reicht bis leicht über das Knie. Ich mag die Vorstellung, dass diese Einstellungsgrösse oft im Western verwendet wurde, um die Cowboys mitsamt ihrer Waffe zu zeigen, wie es auf Wikipedia heisst.[12] Die Waffe durfte nicht angeschnitten werden. Eine kleine Ironie der Ausschnittsgrösse. Meist schauen die Frauen der Fotografin und uns BetrachterInnen horizontal in die Augen. Sie stehen oft aufrecht, mitten auf der Strasse oder auf dem Gehsteig, vor einer Mauer, in einem Park, selten sitzen sie in einem Café und schauen dann hoch oder auf einem Baum und schauen runter zu „uns“. Sie blicken immer in die Kamera und damit in unsere Augen. Die Fotografien erzählen von einer Begegnung, von den abgebildeten Frauen einerseits, aber ebenso von der Fotografin, die sich im Blick, in der Haltung der Frauen spiegelt.
Jitka Hanzlová ist stundenlang zu Fuss durch die fremden Städte marschiert, durch ganz Manhattan, durch Los Angeles, Madrid, London, Essen, Düsseldorf, Berlin und Köln und hat die Frauen mitten in den Städten, mitten auf den Strassen angesprochen und sie gefragt, ob sie sie porträtieren darf. Vier Jahre lang. Die Porträts selbst sind die implizite Einwilligung teilzunehmen. Nahe aufgenommen, aber nicht zu nah, aus einer angenehmen, gebührenden Distanz, die uns erlaubt, genau hinzuschauen, ohne dass wir uns sofort als Eindringlinge fühlen. Die Frauen haben sich kurzfristig entschieden mitzumachen. Diejenigen, die nein gesagt haben, sehen wir nicht. Diejenigen, die ja gesagt haben, wiederum stellen sich in unterschiedlicher Bereitschaft, mit mehr oder weniger Energie hin. Die einen schauen direkt, bestimmt, andere sind zurückhaltend, vorsichtig, abwägend, zögerlich oder leicht verweigernd, leicht verschliessend. Die einen zeigen sich der Kamera, setzen sich und ihr Selbstbild der Kamera selbstbewusst aus, die anderen sind einfach da, werden aufgenommen, manchmal fast etwas wehrlos. Sie zeigen sich nicht nur, wie sie sind, sondern auch, versteckter, woher sie sind, aus welchem Umfeld sie stammen, und wie sie sein, wie sie erscheinen wollen, aber ebenfalls wie sie auf keinen Fall erscheinen wollen. Diese Ebenen überlagern sich mit den Blicken der Fotografin, die in den wenigen Minuten der Begegnung ein Gefühl für die Person, für die Frau entwickelt, das beim Auslösen der Kamera ebenso mitspielt wie der Wunsch, „einfach“ aufzunehmen. Ein vielschichtiges Ereignis, ein kompaktes Schichtprinzip, verbunden mit einigen Erwartungen, die sich wie Blätter übereinanderlegen. Spürbar über das ganze Buch und die Palette an Verhaltensweisen hinweg ist, wie sehr die Fotografierten der Fotografin doch letztlich vertrauten und wie sie sich deshalb auf die Bitte, die Begegnung, das fotografische Spiel auch einlassen haben.
Die Arbeit ist rund 20 Jahre alt, das Buch ist 2000 erschienen. Aus heutiger Sicht fällt, zumindest in meinen Augen, auf, wie unideologisch das Projekt angesetzt ist. Jitka Hanzlová will nichts beweisen, belegen, sie sucht keine Typologie, wohl auch keine Essenz in der Art des typisch Weiblichen, vielmehr sucht sie die konkrete, reale Begegnung mit den Frauen – Frauen jeglichen Alters – für den Augenblick ihres Fotografierens. Die Begegnung ist wichtig, wiederum ein Eins-zu-eins, verbunden mit der Frage, was es heisst, weiblich, „female“ zu sein, losgelöst vom Kontext „Mann“, zumindest im Augenblick der Aufnahme. Sie will die einzelnen Personen direkt sehen und zeigen, wie es nur geht, und sie lässt ihnen, im Rahmen der fotografischen und urbanen Möglichkeiten, die Freiheit, zu sein, wie sie wollen. Ein flüchtiger, zeitlich begrenzter Augenblick eines Aufeinandertreffens von zwei unterschiedlichen Daseinsformen im Augenblick des Kameraklicks. Trotz des hohen Grades an Individualität, an Individualität des Weiblichen, des Female, beginnen wir mit der Zeit zu vergleichen, zum Beispiel das Spiel der Arme – verschränkt, links und rechts hängend, unter dem Rücken verschränkt, den Kopf darin abstützend –, die Arten des Schauens, die Haltungen von Kopf und Körper. „Female“ ist die einzige Arbeit von Jitka Hanzlová, bei der das Konzept von Anfang an feststand.
Vielsalm, Cotton Rose, Brixton und weitere Arbeiten
Es gibt eine Reihe weiterer wichtiger Projekte und Bücher, die ich hier etwas knapper fasse: Zum Beispiel das dünne Büchlein „Vielsalm“, das, wenn man es wie ein Landschaftstheater versteht, in der Gemeinde Vielsalm im Bezirk Bastogne in der belgischen Provinz Luxemburg „spielt“ und vom Ausbruch der Fotografin aus ihrem Auftrag und aus dem geordneten Park dort erzählt: mit dem Rudel von Wildschweinen, die in Einerreihe an uns vorbeitraben, der merkwürdig aufschwellenden, sich zu verlebendigen scheinenden länglich hochsteigenden, eingerahmten Graslichtung, dem Dächer-und Baumwipfel-Netz, eingetaucht in Morgennebel.
Dann das lange nach dem Erstellen erschienene Projekt „Cotton Rose – People and Places“, das auf zwei Reisen durch Japan entstanden ist und in dem Jitka Hanzlová – einerseits aus Respekt den BewohnerInnen, der anderen, fremden Kultur gegenüber, andererseits wegen deren Eingebettetsein in die gestaltete Natur, in ihre Umgebung – die meisten Porträts aus einer grösseren Distanz als üblich aufnimmt.
Oder die Serie von Aufnahmen in „Brixton“, einer Gemeinde im Süden Londons, mit ihrer Afro-Caribbean-Community und ihren heftigen Riots in den Achtzigerjahren. Hier hat Jitka Hanzlová, wie in „Female“ eine Reihe von eindrücklichen Portraits von dunkelhäutigen Frauen in diesem rauen Stadtteil geschaffen, in diesem Fall Porträts, die oft von Vorsicht, von Misstrauen, von Spannungen geprägt sind, Porträts, die sie mit Blicken auf und durch Fenster, auf Blumensträusse, auf ein zerknautschtes Ledersofa konterkarierte.
In den Arbeiten der vergangenen Jahre, den Porträts und den Blumen, verlässt die Künstlerin ihr bisheriges Feld in gewissem Sinne, sie entfernt sich ein Stück weit aus der Wirklichkeit, in dem sie die Menschen und die Blumen vor schwarzem Hintergrund porträtiert. Die Porträts erinnern formal an vergangene Zeiten, an Gemälde, an Renaissance Porträts, die Blumenbilder wieder erinnern an Herbarien, die aber nicht vor hellem Hintergrund, sondern vor filmischem Schwarz aufgenommen worden sind. Sie stellt ihre „Motive“ dadurch in einen theatralen, in einen künstlichen Rahmen, und rückt in den Porträts die Geburt der Identität und in den Blumenstilleben Vanitas, das Vergehen, thematisch in den Vordergrund. „Vanitas“, so der Titel des kleinen, aber kostbaren, besonderen Buchs, das die Vergänglichkeit aller Schönheit, letztlich die grosse Verschwendung des Lebens, den Potlatsch thematisiert. Eine zarte, feingliederige, fotografisch jedoch höchst präzise und wunderschöne Mischung aus Vanitas und Memento Mori – verbunden mit einem leisen Mitklang von Carpe diem – dem „Pflücke den Tag“, „Geniesse das Leben“, „Nutze das Leben“ (im pragmatischen Deutschen) –, der berühmten Sentenz aus einer Ode von Horaz.
In den allerneusten Arbeiten, die erst am Entstehen sind, taucht Jitka Hanzlová ins Wasser ein, in das ihr so zentrale Element und in seine unterschiedlichen Erscheinungen, Aggregatszustände, in Wasser, Eis, Dampf, in die unterschiedlichen Nutzungen auch und die Bedeutungsfelder von Wasser. Auch hier wird es wieder um Sprache, Bild und Existenz gehen, autobiografisch „unterfüttert“ und anschliessend mehrfach transformiert.
Struktur und Form
Die Künstlerin zieht alle ihre Bilder, mit wenigen Ausnahmen, auffallend klein ab. Sie bedient sich nicht raumgreifender Grösse, besetzt nicht die Architektur, entfacht kein Konkurrenzspiel mit den Billboards im Strassenbild der letzten Jahrzehnte. Sie spielt nicht mit den Behauptungen im Feld der Grossfotografie und Grossmalerei im Kunstmarkt heute, vielmehr operiert sie in einer Grösse, die auf der Wand einem Notat gleicht, einer Notiz, einer geschriebenen Seite, einer im Kleinformat kondensierten Bemerkung und Feststellung. Diese mit höchster Präzision gesetzten Ausschnitte, Sehblitze, Sehwinkel, Einschnitte ins Kontinuum von Raum und Zeit, die anschliessend mit grosser Aufmerksamkeit für die Farbbalance, für das Hell-Dunkel-Gleichgewicht abgezogenen C-Prints, mit ihrer oft leichten Untersättigung der Farbe, wie ich zu Beginn geschrieben habe, hängen in der Regel, einfach, bescheiden fast, in Holz gerahmt und auf Augenhöhe an der Wand.
Der inhärente Anspruch dieser kleinen Farbbilder ist hingegen nichts weniger, als das ernste Unternehmen, Wahrheitssplitter zu präsentieren, Wirklichkeitsausschnitte zu suchen, die über sich selbst hinausweisen und mitbedeutend, konnotierend von den Verhältnissen in der Welt und in der Welt von Jitka Hanzlová, von ihren Wirklichkeitswahrnehmungen, ihren Wahrheiten sprechen. Letztlich spüren wir, über die verschiedenen Werkserien der letzten dreissig Jahre hinweg, Schritt für Schritt, Bild für Bild ein Weltbild entstehen, das von einer Einheit von Pflanzen, Tieren und Menschen spricht, von gelebten, genährten, befruchtenden Jahreszeiten, von Jahres- und Lebenszyklen, von der Suche nach positiven, stärkenden und der Abneigung vor negativen, zerstörenden Energien.
Bild fügt sich dabei an Bild, oft in einer Linie, als schreibe sie Wort für Wort einen Satz auf die Wand. Der eine Blick nährt den nächsten, die eine Bedeutung verändert die vorhergehenden Bedeutungen, Sichtbares evoziert Unsichtbares. Die Reihenfolge der Bilder ist mit grösster Sorgfalt gewählt, damit das einzelne Foto mit den anderen zusammen zu „sprechen“ beginnt, damit sich im Kopf des Betrachters, der Betrachterin ein Bedeutungs-, ein Möglichkeits-, ein Wahrscheinlichkeitsfeld auszubreiten beginnt – mit Pausen dazwischen, und viel, viel Stille. Die Arbeiten entstehen wie Feldforschung allmählich beim Machen, beim Suchen, beim Tun, beim Fotografieren. Sie sind weit davon entfernt, Gedankenkunst, Konzeptkunst zu sein, oder sein zu wollen, obwohl sich in ihnen schliesslich wesentliche, grundsätzliche Ideen zum Menschsein heute visualisieren.
Die leichte Untersättigung der Farben (Ausnahmen sind die dunklen saugenden Fotografien in „Forest“) verleihen vielen Bildern eine besondere Helligkeit, als würde alles zur gleichen Zeit leuchten und bräuchte kaum Kontrast und Schwarz zur Stützung der bildlichen Argumente. Und da, wo Jitka Hanzlová die Welt anders sieht, wo sie anders ist, wo sie ihr wehtut, da zeigt sie es auch, mit Winkeln, geometrischen Geraden, mit Schärfe, Blässe und Düsterheit, mit einer Atmosphäre der Abweisung, der Ablehnung.
Das Bildformat an der Wand entspricht in etwa dem Blattformat auf einem Tisch. Jitka Hanzlová „schreibt“ in und mit ihren Bildern ihre Beobachtungen, ihre Geschichte, ihre Gegenwart, ihre Suche nach Lebbarkeit, nach Sinn, nach Wahrheit fotografisch nieder. Im Wissen letztlich um die Unrepräsentierbarkeit von Wahrheit, in einem oder in zwei, drei Bildern, aber gleichwohl in der Überzeugung, dass man sie mit Bildern ständig umkreisen und verengen, durchlaufen und berühren, formulieren und verwerfen und so zumindest erahnen und Stück um Stück begreifen kann. Zusätzlich im Wissen, dass jedes Bild seine eigene Bild-Wahrheit in sich trägt.
Zum Schluss
In einem Emailwechsel zu diesem Text zitiert Jitka Hanzlová David Levi Strauss, den amerikanischen Poeten, Essayisten und Kulturkritiker: “Photography by themselves certainly cannot tell “the whole truth” – they are always only instants. What they do most persistently is to register the relation of the photographer to the subject – the distance from one to another- and this understanding is a profoundly important political process.”[13] Ein Zitat, das ihr Freund John Berger ihr zugesteckt hat.
Ein einzelner Birnbaum macht noch keinen Wald – oder doch? Jedes Einzelne zählt, jeder Laut, jede Stille, jedes Licht, jeder Schatten – und jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch. Nur mit dieser Vorstellung werden wir eine Zukunft haben. Das scheint das Werk von Jitka Hanzlová zu verkörpern – nebst dem Eigensein, Eigenwert ihrer zauberhaft poetischen Bilder.
[1] Jitka Hanzlová, unveröffentlichte Notizen, 2013
[2] Jitka Hanzlová, aus einem unveröffentlichen Vortrag, 2002
[3] John Berger: Between Forest, in: Jitka Hanzlová: Forest. Steidl, Göttingen 2005
[4] Emanuele Coccia, zit. nach Marc Zollinger: Die Natur ist der neue Gott. In: Neue Zürcher Zeitung, 2. 6. 2018
[5] Ebenda, NZZ, 2.6.2018
[6] Ebenda, NZZ, 2.6.2018
[7] Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien, Insel Verlag, Frankfurt a. Main 1955, zit. nach https://gutenberg.spiegel.de/buch/duineser-elegien-829/1 und nach https://gutenberg.spiegel.de/buch/duineser-elegien-829/7
[8] John Berger: Das Leben der Bilder oder die Kunst des Sehens, Berlin: Wagenbach 1980, 12-35
[9] Ebenda, S. 12-35
[10] Ebenda, S. 12-35. In der Bewegung des Veganismus wird seit jüngster Zeit dieses Verhältnis überdacht.
[11] Alexander Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1965
[12] Zit. nach https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellungsgrösse
[13] David Levi Strauss, Between the Eyes: Essays on Photography and Politics. New York: Aperture, 1995, S.10