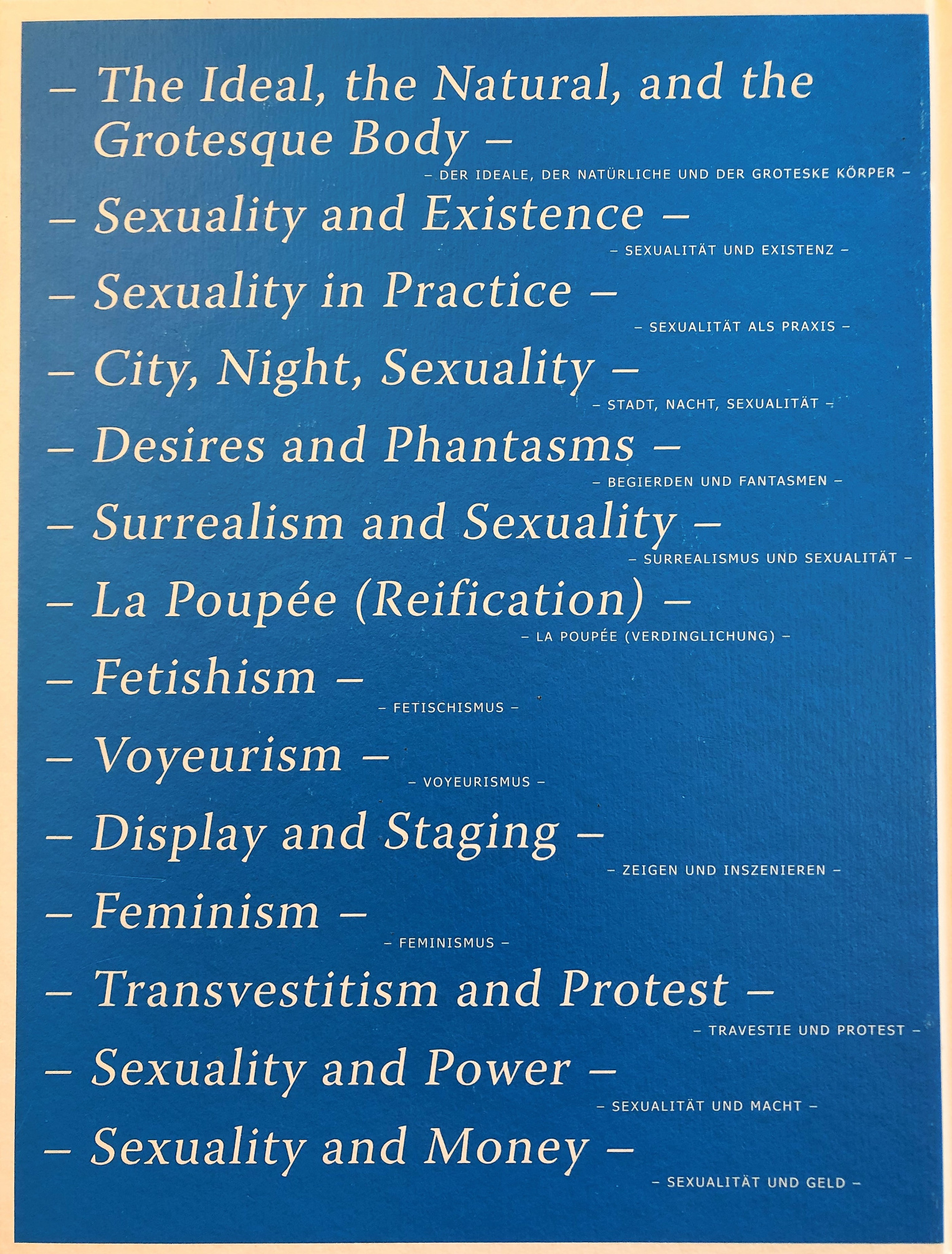Substantivische Benennungen haben oft etwas Tröstliches, Besänftigendes. Ein Sachverhalt ist benannt, den bekannten Mustern, Kategorien zugeordnet worden und kann deshalb bald beruhigt auf die Seite, ad acta gelegt werden. Die Sache ist kategorisiert. Ausschnaufen und sich versichernd gegenseitig den Arm um die Schultern legen. Oder die Benennungen haben etwas Entrückendes, Abstrahierendes: die Dritte Welt, der Tod, die Katastrophe. Das ist alles oft weit weg, abstrakt, berührt wenig, care teams sind ja wohl vor Ort im Einsatz. Es lässt sich darüber reden, ja trefflich debattieren, ein Mitleiden jedoch wäre uncool, etwas gar wie aus dem letzten Jahrhundert. Die Anteilnahme wird delegiert. Dagegen wirken Verben direkter und offener, sie sind wie Bullen auf offenem Feld. Sie rumoren herum, sind in Bewegung, haben keine planbare Richtung. Sie lassen sich nicht einfach wegschieben, sie kratzen sich ein, hinterlassen Spuren, machen uns unruhig. Doch wir können aufspringen und mit ihnen reiten oder uns abwerfen und von ihnen überrollen lassen.
Am Anfang des Buches visualisieren Bilder Energien und Bewegungen: Etwas aufs Spiel setzen, sich hinauswagen, sich einlassen, ohne das Ende des Flusses, des Spiels, des Kampfes zu erahnen. Sich aussetzen, in der Menge treiben lassen und doch die Grenze zwischen „Ich“ und „Alle“ ziehen können. Spiele ohne klares Ende, Kämpfe mit Regeln, Sex verbunden mit Machtspielen, aber immer und zwingend freiwillig: Diese Einstiegsbilder knüpfen an die Ausstellung Darkside I – Fotografische Begierde und fotografierte Sexualität an, entwickeln ähnliche Energien und Situationen. Der Körper geht aus sich heraus, will sich messen, sucht das Risiko, um Lust und Verbindung zu finden. Er springt ins Wasser, steigt in den Ring, setzt seine Integrität aufs Spiel. Ambivalent, aber getrieben von positiven Energien, von Kraft, Ehrgeiz, Erotik.
Der Körper ist hier weitgehend integer, bleibt, obwohl er sich aussetzt, homogen. Er strahlt auch nach dem Kampf, lächelt trotz möglicher körperlicher und mentaler Blessuren. Doch die Grenzen verschieben sich im Fortgang. Free fighting etabliert sich gegenwärtig im Ring und im Alltag. Der Körper als verlässlicher, unersetzbarer Hort des Seins, meist nur natürlichen Schwankungen und Entwicklungen ausgesetzt, wird umdefiniert, neu bestimmt, wird geritzt, gepusht, gespritzt. Er magert ab, richtet sich aus, fügt sich den neuen Bildern. Seine Integrität wird verletzt. Überformt und durchdrungen von vielen kulturellen Körperbildern, von neuen, teils widersprüchlichen Identitäten, wandelt er sich vom Haus zum Werkzeug, zum Instrument, das neu geschliffen, neu poliert, das trainiert und optimiert wird. Mit radikaler Körperaskese (Zweiunddreißig Kilo heißt die Fotoserie von Ivonne Thein), mit hormonellen und chirurgischen Eingriffen wird er den neuen Erfordernissen, dem sich wandelnden, von kulturellen Vorstellungen, von Labels und Brands geprägten Selbst-Bild angepasst. Shifting identities erzeugen shifting bodies. Die Linie zwischen Verschönern und Verstümmeln, zwischen Anpassen und Zerstören ist dabei sehr dünn, die Grenzen zur Verstörung, zur Selbstauslöschung sind schmal und durchlässig. Neue kulturelle Vorstellungen lassen bedeutende Eingriffe zu, irritieren das Selbstverständnis, die Selbstverständlichkeit des Körpers bis zu seiner Zerstörung. Bis zum Selbstmord mit Rattengift (bei Andres Serrano), bis zum Sprung aus dem Fenster (bei Seiichi Furuyas Bilderepos über den Zerfall seiner Frau Christina). Die Freiwilligkeit weicht verschiedenen Zwängen.
Sophie Ristelhuebers Arbeit schlägt – im Kapitel „Versehrte, fügsame und monströse Körper“ – das Thema der verletzten, verwundeten Körper an. Körper, die wuchern, sich verrenken, die „Haken schlagen“. Körper, die beschädigt, vergiftet werden, bis sie vergammeln, bis es in ihnen gärt und fault. Körper, die von Viren, von Krebs befallen sind, von Informationssystemen, die den Körper von innen her schädigen, sein Immunsystem zerstören, es gegen ihn selbst richten, ihn auffressen. Bei Ristelhuebers Bild ist es diese unglaubliche Naht am Rücken. Der Körper muss mit einem langen Schnitt geöffnet worden sein, offengelegt, behandelt und mit vielen Stichen wieder vernäht. Die große Narbe wird lange, wird immer an diesen Akt, an die Offenlegung des Inneren denken lassen. Narben überziehen und prägen die Erde, die Berge, die Menschen, die Körper und Seelen (ein zentrales Thema in Sophie Ristelhuebers Werk) und erinnern an die Fragilität von Körpern, an die temporären oder permanenten Versehrungen. Als Folge von Naturgewalten, von Unfällen oft, im Fall von W. Eugene Smiths Fotografie der jungen, blinden, körperlich deformierten Tomoko Uemura jedoch als Spätfolge nach einer schrecklichen, hochfahrlässigen, ja mörderischen Umweltvergiftung mit Quecksilberabfällen in der Nähe der japanischen Stadt Minamata in den 1950er Jahren. Ist ein Eingriff notwendig, dann delegieren wir den Körper auf Zeit an eine Maschinerie, wir übergeben ihn, verlieren die Kontrolle über ihn (in der Videoarbeit von Aya Ben Ron). Der Körper fügt sich für die Zeit des Eingriffs in ein Außen-, ein Ersatzsystem ein und verliert, demütig fast, seine Souveränität. Psychische, geistige Krankheiten scheinen ihn von innen zu zeichnen, verändern ihn aus sich selbst heraus. Er wirkt, wie in den Bildern von Hugh Welch Diamond und Jerome Liebling, als gebe er den fehlgeleiteten Energieströmen und -impulsen im tiefen Inneren nach, beuge sich nach und nach. Die Natur gebiert, unseren Augen, unserem ästhetischen Sinn entsprechend, gleichermaßen Körper von vollendeter Schönheit und monströse Körper, misslungene Schöpfungen. Das Monströse wohnt in uns, ist Teil des fragilen Gleichgewichts in Natur und Kultur, doch wir delegieren es gern weg, an Stadtränder, in Reagenzgläser, in die Klinik. Wir verscheuchen es aus unseren Blickwinkeln – und geben uns dem Schein hin, dass es sich uns nie wieder nähern werde.
Körper kollidieren, prallen aufeinander, zerbersten, explodieren; Körper werden angeschossen, verletzt, aufgeschlitzt, abgeschossen, vergewaltigt, verstümmelt, zerstückelt; Körper werden hingerichtet, gehängt, geköpft, vergiftet, durch Stromstöße ausgelöscht. Blut läuft aus, Leichen werden verscharrt, weggeschwemmt, verbrannt. Der Energievektor hat seine Richtung gedreht. Der Körper tritt nicht mehr nach außen, setzt sich aus, vermählt sich, erobert seine Welt, vielmehr erfährt er eine heftige Schubumkehr der Energien. Körperliche, mentale und emotionale Gewalten greifen seine Integrität an, verletzten sie, vernichten das geistige und materielle Körpersystem. Bilder von häuslicher Gewalt, von Mordanschlägen, von kriegerischen Angriffen, Bombenexplosionen, Hinrichtungen, Massenvernichtungen, von Volkshass und von struktureller, gesellschaftlicher Gewalt, von Staatsmacht durchziehen die Kapitel „Kollisionskörper“, „Gewalt antun“, „Krieg: Verwüsten und Auslöschen“, „Volksmacht und Staatskörper“.
Gewalt scheint Bilder zu brauchen, Gewalt scheint unsere Bildfantasien zu nähren. Sophie Calle reflektiert innerhalb der Arbeit La lame de rasoir (Rasierklinge) über das Bildwerden von Gewalt, über die Spannung zwischen sichtbarer bildlicher und versteckter realer Gewalt: „Ich arbeitete täglich zwischen 9 und 12 Uhr als Aktmodell für eine Zeichenklasse. Und jeden Tag, drei Stunden lang, zeichnete mich ein Mann, der immer in der ersten Reihe ganz links saß. Mittags holte er dann eine Rasierklinge aus seiner Tasche und zerfetzte seine Zeichnung, als würde er unter einem Zwang stehen. Ich sah ihm dabei zu. Dann verließ er den Raum. Die Zeichnung blieb als Beweis auf dem Tisch. Dies wiederholte sich zwölf Tage lang. Am dreizehnten Tag erschien ich nicht zur Arbeit.“ Es bleibt offen, was mit dem Schnitt der Klinge alles kastriert wird – die Zeichnung, die Zeichenfertigkeit, sexuelle Fantasien – oder was die fotografierte Zeichnung alles impliziert. Sie birgt die Möglichkeiten zur mönchischen Selbstkasteiung wie zum angekündigten Mord.
Allmählich verwittert der Körper, er altert, schrumpft, versteift sich, er vergeht, löst sich auf und verwest (etwa in Bildern von Daniel Schumann, Elisa González Miralles, Sally Mann). Er verliert an Energie, an Spann- und Lebenskraft, seine Systeme kollabieren, fehlgeleitete Prionenfaltungen verändern die Persönlichkeit, entleeren sie stetig und radikal. Selbstbilder verkrusten, gesellschaftliche Körperbilder verwässern, Identitätseifer verliert seinen Elan, seine Wichtigkeit. Was bleibt? Die Behauptung der Würde gegen das Vergehen des Körpers, dann der Tod, der bloße Körper, Rituale der Bestattungen und der Erinnerung, das anatomische Wissen um den Körper (zum Beispiel in Bildern von Adam Fuss, Michael Ackerman, Hans Danuser). Die Verben verstummen. Der Tod ist, im Gegensatz zum Leben, ein wenig greifbarer, abstrakter Begriff, ein Begriff, der sich negativ definiert: Entleerung von Energie, Abwesenheit von Leben, von Beseelung. Ein merkwürdiges, existentielles Nichts. Es bleibt das Nachdenken über das Leben und Ableben, das Hadern, das Versöhnen. Es bleibt die Einsicht in die Notwendigkeit. Einige Autorinnen und Autoren thematisieren im Buch die große Nähe von Fotografie und Tod.
Gewalt zieht Bilder an. Die Bilderwelt des Abendlandes ist voller Gewaltdarstellungen: wilder vagabundierender Gewalt ebenso wie kriegerischer Gewalt, ordnender, staatlicher Gewalt. In merkwürdiger Verkehrung schlossen die Gesellschaften Bilder von lebensbejahender, lebensvermehrender Sexualität weg, belegten sie mit dem Bann der Dunkelheit, des Abseitigen, während Bilder dunkler, exzessiver Gewalt bis heute ans Licht gerückt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und vielschichtig: Sie wirken ähnlich wie Substantive, wie Benennungen, die durch die Darstellung trösten, das Grauen zu fassen versuchen. Sie sind aufputschend, elektrisierend für alle, an denen das Grauen unbeteiligt vorbeigezogen ist. Sie lesen sich wie Mahnmale, wie visuelle Gesetzestafeln, wenn darin staatliche, judikative Gewalt dargestellt wird. Sie wollen aufklärerische, anklagende Manifeste, moralische Anklagen sein, dem abgebildeten Grauen ein Ende setzen. Und sie sind auflagesteigernd. Bilder des Grauens, Schreckens, Mordens und Brennens: schockierende Fotografien faszinieren, aus den angeführten Gründen, aber auch aus einer Lust heraus, ins Dunkle, in die Schattenseiten des zivilisierten, geordneten Lebens zu schauen. Teilhaben, ohne teilzunehmen – ein Voyeurismus der Gewalt und der Gewaltdarstellung.
Die Fotografien von Lynchjustiz vor allem an Schwarzen in Amerika um 1900 demonstrieren dies in besonderer Weise: Nicht nur die vielen Zuschauer, die sich nach der Tat freiwillig dem Fotografen „stellen“, manchmal heiter, gelassen, lachend, sondern auch der befremdliche Umstand, dass solche Fotografien als Postkarten vervielfältigt und, mit herzlichen Grüßen versehen, verschickt worden sind, unterstreichen das Phänomen. Postkarten mit Abbildungen von Gräueln des Ersten Weltkrieges, mit dramatisch drapierten toten Soldaten von der deutsch-französischen Front, oder die mexikanischen Menschenmengen, die sich vor Ort an den Unfällen und Verbrechen und anschließend an den Pressefotos von Enrique Metinides delektieren, verdeutlichen, dass der Voyeurismus der Gewalt weder geografisch noch zeitlich oder kulturell zu beschränken ist. Eine kathartische Wirkung, wie sie seit der griechischen Tragödie mit Darstellungen von Schmerz und Gewalt angestrebt wird, ist in diesen Bildern nicht auszumachen.
Bilder ziehen selbst Gewalt an. Bildern entspringt Kraft, Macht, Gewalt. Sie wollen nicht nur repräsentieren, sondern zeigen, präsent, monstrativ sein. „Jedes Bild ist eine Monstranz. Das Bild ist monströs“, schreibt Jean-Luc Nancy in seinem Aufsatz „Bild und Gewalt“ und fügt bei, „monstrum steht für ein Wunderzeichen …, das vor einer göttlichen Bedrohung warnt.“ „Das Bild ist die wundersame Zeichen-Kraft einer unwahrscheinlichen, aus einer nicht konstruierbaren Unruhe hervorgegangenen Präsenz. Diese Zeichen-Kraft gehört der Einheit an, ohne die es kein Ding, keine Präsenz, kein Subjekt gäbe. Gleichwohl ist die Einheit des Dings, der Präsenz und des Subjekts selbst gewaltsam.“ Und gewaltsam sei sie „kraft eines Strahls von Gründen“: Sie müsse auftreten können, sich den verstreuten Vielheiten entziehen, vereinfachen können, sie muss sich aus dem Nichts erheben, sich nach außen darstellen, all das ausschließen, was sie nicht sein soll. Eine gewaltsame Vereinfachung zugunsten der eigentlichen Präsenz, schreibt Nancy.
Dieser Bildkraft sind die Kraft des Faktischen, die Macht der realitätsnahen Darstellung in der Fotografie beizufügen, verbunden mit dem framing, dem örtlichen und zeitlichen Ausschneiden des Bildes aus dem Kontinuum der Wirklichkeit durch den Sucher der Kamera, und die Wahl von Zeit und Blende, das absolute Bestimmen dessen also, was ins Bild kommt und was herausfällt, was nahe und was nur von weit weg, was scharf und was unscharf gezeigt wird. Diese Macht, die jedes zeitfaktische „Es ist gewesen“ in ein bestimmtes, ein begründendes „So will ich (der Fotograf) es gesehen haben“ verwandelt, ist eine dem Medium Fotografie innewohnende Eigenschaft. Darüber hinaus erkennen wir eine Art performativer Macht: Der Akt des Fotografierens ist nicht nur ein Dokumentieren, er ist immer auch ein Eingriff ins Geschehen. Kinder lachen, Frauen weinen – weil sie fotografiert werden. Bestimmte kriegerische Akte geschehen nur, weil eine Kamera (ein Fotoapparat, eine Fernsehkamera) zugegegen ist. Thomas Macho beginnt seinen Aufsatz hier im Buch mit einem berühmten Beispiel aus der Fotogeschichte: „Bilder können den Kontext ihrer Entstehung nicht dokumentieren; so viel lässt sich bereits an jenem berühmten Lichtbild demonstrieren, das Robert Capa während des Spanischen Bürgerkriegs am 5. September 1936 fotografiert hat. Die oft kommentierte Synchronisation des Blendenverschlusses mit dem Einschlag der Kugel, die den 24-jährigen Milizionär Federico Borrell Garcia tötete, ereignete sich damals nicht zufällig, sondern bei Gefechten, die eigens für das Auge der Kamera inszeniert wurden.“
Liegt das Foto erst einmal vor, so stellen sich weitere Fragen. Daniel Tyradellis und Burkhardt Wolf haben in ihrem Aufsatz „Hinter den Kulissen der Gewalt“ eine Fotografie von Jeffrey Silverthorne aus der Gerichtsmedizin analysiert und gefragt, was das Gewalttätige des fotografischen „Momentes“ beinhalte. Sie fanden leicht acht bemerkenswerte Punkte: 1. Die Gewalt selbst, die das Foto dokumentiert. 2. Die Gewalt, die die abgebildeten Polizisten im Namen einer Institution ausüben, indem sie eine Maschinerie in Gang setzen, um zuletzt dem Täter (rechtmäßige) Gewalt anzutun. 3. Der gewaltsame Akt, das „Sakrileg“ des Fotografen, einen leblosen Menschen in einer solchen Situation aufzunehmen. 4. Die journalistische oder künstlerische „Gewalttat“, das Bild zu veröffentlichen und uns das womöglich Intimste, das Bild des toten Körpers, zu präsentieren. 5. Die ungeschönte Perspektive, das Bild genau so zu schießen und unseren Blick radikal zu lenken. 6. Die Gewalt oder eigentümliche Konsequenz, mit der die Fotografie nachträglich bearbeitet wurde. 7. Die Schonungslosigkeit, mit der die Herausgeber dieses Foto als Titelbild gewählt haben und es so Lesern ungefragt präsentieren. 8. Die Gewalt oder der Eigensinn der Betrachter, ihrerseits das aus dem Bild herauszulesen, was ihnen dazu einfällt. Schließlich ist als (vorläufig) Letztes beizufügen: diese unglaubliche Macht, die Fotografie, vor allem publizierte Fotografie, auf unser Gedächtnis ausübt. Seit 150 Jahren dominiert wesentlich das, was fotografiert wurde, im individuellen und kollektiven Gedächtnis und hat entsprechend Gewicht.
„... it is not by means of the image that moral, ethical, or political knowledge is produced“, zitiert Abigail Solomon-Godeau Platon zu Fragen der Ästhetisierung des Grauens. Rund 2400 Jahre später leben wir in einer visuell aufgerüsteten Medienwelt, in der das Neue, noch Nähere, noch Schrecklichere redundant geworden sind. Und Trotta, eine Figur in der Erzählung „Drei Wege zum See“ von Ingeborg Bachmann, klagt seiner Freundin, einer Fotografin: „Glaubst du, daß du mir die zerstörten Dörfer und die Leichen abfotografieren mußt, damit ich mir den Krieg vorstelle, oder diese indischen Kinder, damit ich weiß, was Hunger ist? Was ist das denn für eine dumme Anmaßung. ... man schaut sich doch Tote nicht zur Stimulierung für Gesinnung an.“ Die Fragen, für wen Bilder von Krankheit, Gewalt und Tod gemacht werden, wer der Absender, der Auftraggeber, der Adressat ist, welche Absicht damit verbunden, auch wie viel Geld im Spiel und wie edel der Abzug ist – all diese Fragen sind bei Bildern des Grauens, des körperlichen, menschlichen Schreckens immer wieder von Neuem zu stellen, denn es ist selten das Bild allein, sondern immer der Gesamtkontext, der solch heftige Bildwelten entweder als sinnvoll oder als sinnlos, gar als nur noch schrecklich erscheinen lässt. Jedoch gilt: Die Realität ist immer gewalttätiger als jede Bildwelt.